mit Büchern von John Jeremiah Sullivan, Dietmar Dath, Bert Rebhandl, Dominik Graf und Lily Brett.
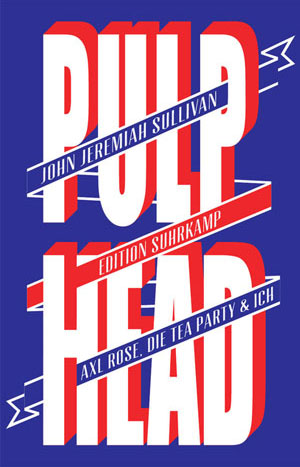 // John Jeremiah Sullivan aus North Carolina hat in den vergangenen Jahren nicht nur für zahllose Magazine wie das „New York Times Magazine“ oder die „GQ“ in die Tasten gegriffen, er hat auch zweimal den renommierten „National Magazine Award“ abgestaubt. Mit „Pulphead“ erscheint nun sein zweiter Roman nach 2008 und der ist gespickt mit zahllosen Seitenhieben auf den Zeitgeist der vergangenen Jahre. In seinen Geschichten widmet er sich nicht nur der tragischen Figur des Michael Jackson, er wandelt im Rahmen seiner Essays auch auf den Spuren des renommierten Schriftstellers und Journalisten Hunter S. Thompson.
// John Jeremiah Sullivan aus North Carolina hat in den vergangenen Jahren nicht nur für zahllose Magazine wie das „New York Times Magazine“ oder die „GQ“ in die Tasten gegriffen, er hat auch zweimal den renommierten „National Magazine Award“ abgestaubt. Mit „Pulphead“ erscheint nun sein zweiter Roman nach 2008 und der ist gespickt mit zahllosen Seitenhieben auf den Zeitgeist der vergangenen Jahre. In seinen Geschichten widmet er sich nicht nur der tragischen Figur des Michael Jackson, er wandelt im Rahmen seiner Essays auch auf den Spuren des renommierten Schriftstellers und Journalisten Hunter S. Thompson.
In „Pulphead“ widmet er sich sehr intensiv seinem jeweiligen Objekt der Begierde und hat auf diese Weise die Möglichkeit, die einzelnen Facetten der jeweiligen Figur intensiv herauszuarbeiten. Wer bitteschön schreibt denn heutzutage noch ein Essay über eine Figur wie Axl Rose, werden sie sich als Leser zu Recht fragen. Und sie haben recht… Das macht wirklich kein Mensch mehr und doch ist es genau dieser Blick über den Tellerrand, der dieses Werk so faszinierend macht. Ein Werk, welches -ganz nebenbei bemerkt- aus mehreren Beiträgen besteht, die in den vergangenen Jahren in diversen Publikationen schon einmal veröffentlicht worden sind. Trotzdem funktioniert „Pulphead“ als Gesamtkunstwerk. Was wiederum daran liegt, dass sich Sullivans unverwechselbarer Stil wie ein roter Faden durch die einzelnen Beiträge zieht, welche sich unter anderem mit Bunny Wailer (dem einzigen Überlebenden von Bob Marley ehemaliger Band The Wailers) oder dem Besuch eines christlichen Rock-Festivals auseinander setzen. Wer auf raffiniert-getextete „Pulp“-Literatur mit Kultpotenzial steht, sollte mal reinschnuppern. Es lohnt sich – und zwar nicht nur für Guns´n´Roses-Fans.
 // Und nachdem uns der „diaphanes“-Verlag bereits vor Kurzem mit gelungenen Booklets zu allseits beliebten TV-Serien wie „Sopranos“ oder „The Wire“ versorgte, steht nun auch die zweite Staffel der „Booklet“-Reihe in den Regalen. Darin widmet sich der renommierte Schriftsteller Dietmar Dath dem TV-Ereignis „Lost“, das zwar vom inhaltlichen Anspruch her nicht annährend an die die vorab genannten Serien heranreicht, aber als Phänomen durchaus diskussionswürdig ist. Gerade im Rahmen der ersten Staffel gelingt es der Reihe ein irrsinnig hohes Spannungs-Level zu kreieren, das bis zum Ende nicht abebbt. „Lost“ lebt dabei immer von der unsichtbaren Gefahr, die von den Machern Schritt für Schritt sichtbar gemacht wird (nehmen wir hier zum Beispiel mal „The Others“, deren Beweggründe sich für die Gestrandeten (und auch den Zuschauer) erst nach und nach erschließen, was einen natürlich nur umso neugieriger macht). Die Macher deklinieren dieses Schema bis zum Ende der Serie mehr oder weniger zielführend durch und halten die Zuschauer so bei der Stange.
// Und nachdem uns der „diaphanes“-Verlag bereits vor Kurzem mit gelungenen Booklets zu allseits beliebten TV-Serien wie „Sopranos“ oder „The Wire“ versorgte, steht nun auch die zweite Staffel der „Booklet“-Reihe in den Regalen. Darin widmet sich der renommierte Schriftsteller Dietmar Dath dem TV-Ereignis „Lost“, das zwar vom inhaltlichen Anspruch her nicht annährend an die die vorab genannten Serien heranreicht, aber als Phänomen durchaus diskussionswürdig ist. Gerade im Rahmen der ersten Staffel gelingt es der Reihe ein irrsinnig hohes Spannungs-Level zu kreieren, das bis zum Ende nicht abebbt. „Lost“ lebt dabei immer von der unsichtbaren Gefahr, die von den Machern Schritt für Schritt sichtbar gemacht wird (nehmen wir hier zum Beispiel mal „The Others“, deren Beweggründe sich für die Gestrandeten (und auch den Zuschauer) erst nach und nach erschließen, was einen natürlich nur umso neugieriger macht). Die Macher deklinieren dieses Schema bis zum Ende der Serie mehr oder weniger zielführend durch und halten die Zuschauer so bei der Stange.  Wahrscheinlich fragt Dath auch deshalb „ Was geht hier eigentlich vor?“ Er möchte auf das System hinweisen, dass sich hinter all den Andeutungen versteckt. Er durchleuchtet die Geschehnisse und entzaubert dadurch (wie auch die Macher selbst) die einzelnen Figuren, indem er sie einer immer differenzierteren Analyse unterzieht. Der freie Journalist Bert Rebhandl hat da in seiner Abhandlung zum Thema „Seinfeld“ schon weniger Geheimnisse zu lüften. Die Comedy-Reihe, die von 1989 bis 1998 auch hierzulande ziemlich erfolgreich gelaufen ist, hat keinerlei Verschwörungstheorien im Gepäck. Stattdessen wird das Dasein von Protagonist Jerry Seinfeld und seinen Kumpels George, Elaine und Kramer in allen erdenklichen Einzelheiten durchdekliniert. Dabei deckt er unter anderem auf, was lange Zeit den Reiz einer witzigen Sitcom ausgemacht hat. Es ist die stetige Nicht-Entwicklung der einzelnen Figuren, die einen an „Seinfeld“ so fasziniert. Die handelnden Personen kommen einem auf diese Weise schon nach kurzer Zeit wie alte Bekannte vor, die immer nach dem gleichen, verlässlichen Muster handeln. Dominik Graf wiederum, der mit „Im Angesicht des Verbrechens“ die wahrscheinlich komplexeste und mutigste (deutsche) TV-Serie der vergangenen Jahre gedreht hat, nimmt sich in seinem Buch der amerikanischen Polizisten-Reihe „Homicide“ an.
Wahrscheinlich fragt Dath auch deshalb „ Was geht hier eigentlich vor?“ Er möchte auf das System hinweisen, dass sich hinter all den Andeutungen versteckt. Er durchleuchtet die Geschehnisse und entzaubert dadurch (wie auch die Macher selbst) die einzelnen Figuren, indem er sie einer immer differenzierteren Analyse unterzieht. Der freie Journalist Bert Rebhandl hat da in seiner Abhandlung zum Thema „Seinfeld“ schon weniger Geheimnisse zu lüften. Die Comedy-Reihe, die von 1989 bis 1998 auch hierzulande ziemlich erfolgreich gelaufen ist, hat keinerlei Verschwörungstheorien im Gepäck. Stattdessen wird das Dasein von Protagonist Jerry Seinfeld und seinen Kumpels George, Elaine und Kramer in allen erdenklichen Einzelheiten durchdekliniert. Dabei deckt er unter anderem auf, was lange Zeit den Reiz einer witzigen Sitcom ausgemacht hat. Es ist die stetige Nicht-Entwicklung der einzelnen Figuren, die einen an „Seinfeld“ so fasziniert. Die handelnden Personen kommen einem auf diese Weise schon nach kurzer Zeit wie alte Bekannte vor, die immer nach dem gleichen, verlässlichen Muster handeln. Dominik Graf wiederum, der mit „Im Angesicht des Verbrechens“ die wahrscheinlich komplexeste und mutigste (deutsche) TV-Serie der vergangenen Jahre gedreht hat, nimmt sich in seinem Buch der amerikanischen Polizisten-Reihe „Homicide“ an. 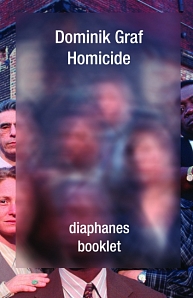 Selbige diente nicht nur als Inspirationsquelle für die preisgekrönten amerikanischen Krimi-Serie „The Wire“, die (wie oben bereits erwähnt) ebenfalls mit einem Booklet von „diaphanes“ geadelt wurde, „Homicide“ hat auch die Art und Weise des Erzählens im Fernsehen nachhaltig beeinflusst. In der Serie stehen nicht mehr länger die Kriminalfälle, sondern die agierenden Personen im Mittelpunkt des Geschehens. Die Reihe versucht im höchsten Maße realistisch zu sein, was ihr auch überaus gut gelingt. Das liegt unter anderem daran, dass Buchautor David Simon an der TV-Serie mitgewirkt hat, dessen gleichnamiges Buch „Homicide“ auf seinen Erfahrungen im Polizisten-Milieu beruht. Im Gegensatz zu vielen früheren Serien ist bei „Homicide“ deshalb schon beim Casting darauf geachtet worden, dass die Schauspieler ihre Figuren auch glaubwürdig verkörpern können. So wurde in der Darsteller-Riege auf hübsche Poster-Boys verzichtet (selbiges ist inzwischen vor allem bei jüngeren amerikanischen TV-Reihen immer öfter der Fall – nehmen wir beispielhaft diverse TV-Reihen des amerikanischen Pay-TV-Sender HBO, wie zum Beispiel „The Sopranos“, „The Wire“ und „Oz“ oder eingeschränkt auch „Carnivale“, „Deadwood“ und „Big Love“). Wer mehr wissen möchte, sollte unbedingt mal in die 2. Staffel der „diaphanes“-Reihe reinschnuppern. Diese Booklets sind ein gefundenes Fressen für jeden TV-Serien-Fan. Und wir freuen uns jetzt schon auf Weiteres, was da noch kommen mag.
Selbige diente nicht nur als Inspirationsquelle für die preisgekrönten amerikanischen Krimi-Serie „The Wire“, die (wie oben bereits erwähnt) ebenfalls mit einem Booklet von „diaphanes“ geadelt wurde, „Homicide“ hat auch die Art und Weise des Erzählens im Fernsehen nachhaltig beeinflusst. In der Serie stehen nicht mehr länger die Kriminalfälle, sondern die agierenden Personen im Mittelpunkt des Geschehens. Die Reihe versucht im höchsten Maße realistisch zu sein, was ihr auch überaus gut gelingt. Das liegt unter anderem daran, dass Buchautor David Simon an der TV-Serie mitgewirkt hat, dessen gleichnamiges Buch „Homicide“ auf seinen Erfahrungen im Polizisten-Milieu beruht. Im Gegensatz zu vielen früheren Serien ist bei „Homicide“ deshalb schon beim Casting darauf geachtet worden, dass die Schauspieler ihre Figuren auch glaubwürdig verkörpern können. So wurde in der Darsteller-Riege auf hübsche Poster-Boys verzichtet (selbiges ist inzwischen vor allem bei jüngeren amerikanischen TV-Reihen immer öfter der Fall – nehmen wir beispielhaft diverse TV-Reihen des amerikanischen Pay-TV-Sender HBO, wie zum Beispiel „The Sopranos“, „The Wire“ und „Oz“ oder eingeschränkt auch „Carnivale“, „Deadwood“ und „Big Love“). Wer mehr wissen möchte, sollte unbedingt mal in die 2. Staffel der „diaphanes“-Reihe reinschnuppern. Diese Booklets sind ein gefundenes Fressen für jeden TV-Serien-Fan. Und wir freuen uns jetzt schon auf Weiteres, was da noch kommen mag.
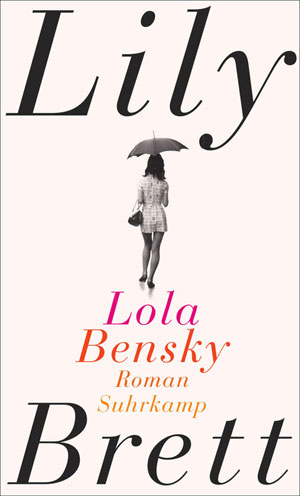 // Wer auf Pop in Literaturform steht, der sollte sich mal an das aktuelle Werk von der New Yorker Autorin Lily Brett heranwagen. Die führt uns in ihrem Roman „Lola Bensky“ in die 60er zurück und knallt ihren Lesern eine gleichnamige Protagonistin vor den Latz, die sich ihren Lebensunterhalt als Reporterin zu sichern versucht. Lola Bensky ist gerade einmal 19 Jahre jung und trifft im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht nur auf Rockstar-Größen wie Mick Jagger und Jimi Hendrix – sie geht auch ziemlich unkonventionell an die ganze Geschichte heran. Anstatt sich nämlich in die Liste der Autoren einzureihen, die immer wieder neue Klatsch- und Tratsch-Geschichten über diverse Berühmtheiten aus dem Ärmel schütteln, experimentiert sie lieber ein bisschen herum und verleiht ihren Reportagen auf diese Weise eine eigene Note. Einzig und allein ihre Eltern sollen auf keinen Fall etwas von ihrem Job als rasende Reporterin erfahren, weil sie sonst nie wieder ein Auge zudrücken könnten, während die Tochter gerade mit drogensüchtigen Rock-Stars durch die Diskotheken der Stadt zieht. Wenn es nach Lolas Eltern gehen würde, hätte die junge Dame lieber Anwältin werden sollen… wobei diese Diskrepanz zwischen Vorstellung und Wirklichkeit immer wieder für ein breites Grinsen auf dem Gesicht des Lesers sorgt. Ansonsten gelingt der Autorin mit „Lola Bensky“ eine leicht verdauliche, mit zahlreichen Pop-Referenzen durchsetzte Geschichte, die einfach nur glücklich macht. Kann man mehr verlangen? Wir denken nicht.
// Wer auf Pop in Literaturform steht, der sollte sich mal an das aktuelle Werk von der New Yorker Autorin Lily Brett heranwagen. Die führt uns in ihrem Roman „Lola Bensky“ in die 60er zurück und knallt ihren Lesern eine gleichnamige Protagonistin vor den Latz, die sich ihren Lebensunterhalt als Reporterin zu sichern versucht. Lola Bensky ist gerade einmal 19 Jahre jung und trifft im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht nur auf Rockstar-Größen wie Mick Jagger und Jimi Hendrix – sie geht auch ziemlich unkonventionell an die ganze Geschichte heran. Anstatt sich nämlich in die Liste der Autoren einzureihen, die immer wieder neue Klatsch- und Tratsch-Geschichten über diverse Berühmtheiten aus dem Ärmel schütteln, experimentiert sie lieber ein bisschen herum und verleiht ihren Reportagen auf diese Weise eine eigene Note. Einzig und allein ihre Eltern sollen auf keinen Fall etwas von ihrem Job als rasende Reporterin erfahren, weil sie sonst nie wieder ein Auge zudrücken könnten, während die Tochter gerade mit drogensüchtigen Rock-Stars durch die Diskotheken der Stadt zieht. Wenn es nach Lolas Eltern gehen würde, hätte die junge Dame lieber Anwältin werden sollen… wobei diese Diskrepanz zwischen Vorstellung und Wirklichkeit immer wieder für ein breites Grinsen auf dem Gesicht des Lesers sorgt. Ansonsten gelingt der Autorin mit „Lola Bensky“ eine leicht verdauliche, mit zahlreichen Pop-Referenzen durchsetzte Geschichte, die einfach nur glücklich macht. Kann man mehr verlangen? Wir denken nicht.
UND WAS NUN?