 Die Nacht ist zu Ende. Ein Pärchen liegt am Strand. Die aufgehende Sonne spiegelt sich in der Wasseroberfläche. Die Sonnenstrahlen kitzeln sanft die Körper des Liebespaars. Die Augen öffnen sich. Sie gähnt. Er streckt seine Arme gen Himmel. Und dann drückt irgendwo jemand auf Play. Musik ertönt: die neue Scheibe der Black Kids (klickt auf den Interpreten und ihr gelangt zum Reinhören sofort auf dessen Myspace Seite) aus Florida. Sie fühlt sich an, wie ein einziger Hitreigen. Ähnlich wie der Erstling der Killers schleicht sich das Album „Partie Traumatic“ (7) nicht sanft an einen heran. Es überfällt einen mit all seinem Schönklang. Die ersten sechs Songs sind allesamt Hitsingles. Der siebte ein Welthit. Er hört auf den Namen „I´m not gonna teach your boyfriend how to dance with you“ und er ist so bezaubernd, dass die beiden Verliebten sich an die Hände nehmen und mit nackten Füßen im Kreis tanzen. Der Sand unter ihren Füßen wirkt wie ein nicht enden wollender roter Teppich. Und sie scheinen zu schweben, bis sich die Platte ihrem Ende neigt. Da singt irgendjemand etwas von „kiss your lips“. Und es wirkt fast zu perfekt, um wahr zu sein. Beinahe traumatisch schön, wodurch es dann erst mal an der Zeit ist wieder runterzukommen. Bestens geeignet dazu: Das vierte Album der Constantines aus
Die Nacht ist zu Ende. Ein Pärchen liegt am Strand. Die aufgehende Sonne spiegelt sich in der Wasseroberfläche. Die Sonnenstrahlen kitzeln sanft die Körper des Liebespaars. Die Augen öffnen sich. Sie gähnt. Er streckt seine Arme gen Himmel. Und dann drückt irgendwo jemand auf Play. Musik ertönt: die neue Scheibe der Black Kids (klickt auf den Interpreten und ihr gelangt zum Reinhören sofort auf dessen Myspace Seite) aus Florida. Sie fühlt sich an, wie ein einziger Hitreigen. Ähnlich wie der Erstling der Killers schleicht sich das Album „Partie Traumatic“ (7) nicht sanft an einen heran. Es überfällt einen mit all seinem Schönklang. Die ersten sechs Songs sind allesamt Hitsingles. Der siebte ein Welthit. Er hört auf den Namen „I´m not gonna teach your boyfriend how to dance with you“ und er ist so bezaubernd, dass die beiden Verliebten sich an die Hände nehmen und mit nackten Füßen im Kreis tanzen. Der Sand unter ihren Füßen wirkt wie ein nicht enden wollender roter Teppich. Und sie scheinen zu schweben, bis sich die Platte ihrem Ende neigt. Da singt irgendjemand etwas von „kiss your lips“. Und es wirkt fast zu perfekt, um wahr zu sein. Beinahe traumatisch schön, wodurch es dann erst mal an der Zeit ist wieder runterzukommen. Bestens geeignet dazu: Das vierte Album der Constantines aus  Kanada. „Kensington Heights“ (7) ist ein verworrenes, bisweilen schwer durchdringbares Dickicht an Sträuchern, deren Wurzeln im Punk, Grunge und Dub liegen. Trotzdem legt man die Scheibe immer wieder gerne ein. Sie fordert einen, überfordert einen aber nicht. Stattdessen hört man diesen Gitarren nur allzu gerne dabei zu, wie sie quer schießen, während die schmachtenden Worte des Sängers eine Geschichte erzählen. „There´s no short cut. And no straight line”. Dieses Album versteht es die Musik wieder von ihrem Status als Gebrauchsgut zu emanzipieren. Ist ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich im zehn Sekunden-Takt durch ihre überfüllten Festplatten zappen, um ihrer riesigen Sammlung an Sounds verzweifelt ein Gefühl zu entlocken. Diese Scheibe ist ein Gegenentwurf. Sie sticht aus der Masse heraus. Und sie zeigt auf, wie schön eine Ballade, wie „New King“ klingen kann, wenn sie von solch hinreißend dreckigen und rockigen Sounds umhüllt wird. Womit wir dann auch schon beim nächsten Höhepunkt angelangt wären. Jedenfalls will sich mir auch nach zahlreichen Durchläufen von RZAs neuem Album nicht erschließen, warum die Reaktionen im Blätterwald so verhalten ausfallen. Eingestimmt von dem tollen Superhelden Comic-Strip im Booklet, macht sich RZA as Bobby Digital auf
Kanada. „Kensington Heights“ (7) ist ein verworrenes, bisweilen schwer durchdringbares Dickicht an Sträuchern, deren Wurzeln im Punk, Grunge und Dub liegen. Trotzdem legt man die Scheibe immer wieder gerne ein. Sie fordert einen, überfordert einen aber nicht. Stattdessen hört man diesen Gitarren nur allzu gerne dabei zu, wie sie quer schießen, während die schmachtenden Worte des Sängers eine Geschichte erzählen. „There´s no short cut. And no straight line”. Dieses Album versteht es die Musik wieder von ihrem Status als Gebrauchsgut zu emanzipieren. Ist ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich im zehn Sekunden-Takt durch ihre überfüllten Festplatten zappen, um ihrer riesigen Sammlung an Sounds verzweifelt ein Gefühl zu entlocken. Diese Scheibe ist ein Gegenentwurf. Sie sticht aus der Masse heraus. Und sie zeigt auf, wie schön eine Ballade, wie „New King“ klingen kann, wenn sie von solch hinreißend dreckigen und rockigen Sounds umhüllt wird. Womit wir dann auch schon beim nächsten Höhepunkt angelangt wären. Jedenfalls will sich mir auch nach zahlreichen Durchläufen von RZAs neuem Album nicht erschließen, warum die Reaktionen im Blätterwald so verhalten ausfallen. Eingestimmt von dem tollen Superhelden Comic-Strip im Booklet, macht sich RZA as Bobby Digital auf  HipHop-Sourensuche durch lo-fi-elektronische Arrangements („Long Time Coming“) und ausufernde Jams (das über achtminütige Monster von Song „You Can´t Stop Me Now“). Die Scheibe rollt dabei entspannt vor sich hin, setzt aber punktuell auch immer wieder Pop-Akzente („Try Ya Ya Ya“ und “Up Again”). Dazwischen schleichen sich charmante Wortspiele. Manchmal allerdings auch austauschbares Dicke Hose-Gepose, das der „Clan“-Member überhaupt nicht nötig hat. Mit seinem Rap-Flow, so einzigartig, wie selbstgebackene Kekse, reißt er einen kurzerhand aus der Realität und macht dabei höchstens noch den Fehler, nicht rechtzeitig auf „Stop“ zu drücken. Zugegeben. Fokussiertes Arbeiten war nun wirklich noch nie seine Sache… trotzdem wäre „Digi Snacks“ (6) wohl, hätte er es auf die zahlreichen Höhepunkte beschränkt, nahe an einem Klassiker vorbei geschrammt. So wirkt es dennoch imposant, und hinterlässt einen in der Hoffnung, dass es vielleicht beim nächsten Mal wieder so weit sein könnte. Diese Musik ist schließlich wie geschaffen, um abzuheben. Das kann man anschließend auch zum Sound der Dualers. Einem
HipHop-Sourensuche durch lo-fi-elektronische Arrangements („Long Time Coming“) und ausufernde Jams (das über achtminütige Monster von Song „You Can´t Stop Me Now“). Die Scheibe rollt dabei entspannt vor sich hin, setzt aber punktuell auch immer wieder Pop-Akzente („Try Ya Ya Ya“ und “Up Again”). Dazwischen schleichen sich charmante Wortspiele. Manchmal allerdings auch austauschbares Dicke Hose-Gepose, das der „Clan“-Member überhaupt nicht nötig hat. Mit seinem Rap-Flow, so einzigartig, wie selbstgebackene Kekse, reißt er einen kurzerhand aus der Realität und macht dabei höchstens noch den Fehler, nicht rechtzeitig auf „Stop“ zu drücken. Zugegeben. Fokussiertes Arbeiten war nun wirklich noch nie seine Sache… trotzdem wäre „Digi Snacks“ (6) wohl, hätte er es auf die zahlreichen Höhepunkte beschränkt, nahe an einem Klassiker vorbei geschrammt. So wirkt es dennoch imposant, und hinterlässt einen in der Hoffnung, dass es vielleicht beim nächsten Mal wieder so weit sein könnte. Diese Musik ist schließlich wie geschaffen, um abzuheben. Das kann man anschließend auch zum Sound der Dualers. Einem  ziemlich radiotauglichen Reggae-Entwurf, der in England schon zwei Mini-Hits abwarf. Auf „The Melting Pot“ (4) landen sie dabei irgendwo zwischen Jamiroquai und Mattafix. Wagen dabei allerdings auch einige Abstecher in Ska-Gefilde. Trotzdem nervt die poppige Produktion auf Albumlänge etwas, weil die Songs neben den geradlinigen Melodien nur wenig zu bieten haben, was sie aus der Masse herausstechen lässt. Das heißt jetzt nicht etwa, dass man sich zu dieser Platte nicht perfekt in die Hängematte schmeißen könnte und fröhlich vor sich hinschaukeln könnte. Man sollte nur aufpassen, dass man dabei nicht einschläft. Wobei. Es gibt ja noch Derek Meins. Ein imposanter Songwriter, 21 Jahre jung, der dich mit „The Famous Poet“ (5) wieder sanft in die Realität zurückholt. Vor allem in grandiosen Opener „The Freud Song“ macht er sofort klar, welche Qualitäten in ihm schlummern. Leider verliert sich das Album mit zunehmender Länge in konfusen poetischen Ergüssen, die a-capella ablaufen. Und diese bierseligen Mitgröhl-Refrains
ziemlich radiotauglichen Reggae-Entwurf, der in England schon zwei Mini-Hits abwarf. Auf „The Melting Pot“ (4) landen sie dabei irgendwo zwischen Jamiroquai und Mattafix. Wagen dabei allerdings auch einige Abstecher in Ska-Gefilde. Trotzdem nervt die poppige Produktion auf Albumlänge etwas, weil die Songs neben den geradlinigen Melodien nur wenig zu bieten haben, was sie aus der Masse herausstechen lässt. Das heißt jetzt nicht etwa, dass man sich zu dieser Platte nicht perfekt in die Hängematte schmeißen könnte und fröhlich vor sich hinschaukeln könnte. Man sollte nur aufpassen, dass man dabei nicht einschläft. Wobei. Es gibt ja noch Derek Meins. Ein imposanter Songwriter, 21 Jahre jung, der dich mit „The Famous Poet“ (5) wieder sanft in die Realität zurückholt. Vor allem in grandiosen Opener „The Freud Song“ macht er sofort klar, welche Qualitäten in ihm schlummern. Leider verliert sich das Album mit zunehmender Länge in konfusen poetischen Ergüssen, die a-capella ablaufen. Und diese bierseligen Mitgröhl-Refrains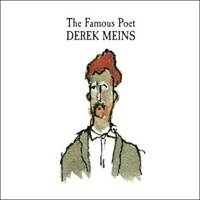 in „Oh! You Pretty Woman“ und „Honey Girl“ kann man auch nur bedingt gutheißen. Aber dann packt er dich plötzlich mit dem wunderbaren „End Of Man“ wieder am Kragen und schüttelt dich mit seiner bezaubernden Stimme durch, dass du meinst, hier würde der perfekte Duett-Partner für Conor Oberst vor dir stehen. Danach wird dann allerdings wieder gedichtet. Und am Ende ist man zunehmend verwirrt über die Motivation des Musikers. Und wendet sich ratlos der charmanten Amanda Palmer zu. Die Dresden Dolls-Sirene hat nämlich ihr heiß erwartetes Solo-Album am Start. Und „Who Killed Amanda Palmer?” (6) wirkt wie ein aufreizender Nostalgie-Trip in vergangene Zeiten. Die Punk-Attitüde der Dolls wurde dabei nur geringfügig gedrosselt und die Stücke entpuppen sich trotz der Unterstützung von Ben Folds am Piano als überraschend forsche Tanzflächenfüller. Zumindest zu Beginn der Scheibe. Da werden absolut keine Anstalten gemacht, sich beim Seitensprung auf allzu gefühlsduselige Gemütszustände einzulassen. Stattdessen wird mal so richtig Dampf abgelassen. Die Nacht zum Tag gemacht.
in „Oh! You Pretty Woman“ und „Honey Girl“ kann man auch nur bedingt gutheißen. Aber dann packt er dich plötzlich mit dem wunderbaren „End Of Man“ wieder am Kragen und schüttelt dich mit seiner bezaubernden Stimme durch, dass du meinst, hier würde der perfekte Duett-Partner für Conor Oberst vor dir stehen. Danach wird dann allerdings wieder gedichtet. Und am Ende ist man zunehmend verwirrt über die Motivation des Musikers. Und wendet sich ratlos der charmanten Amanda Palmer zu. Die Dresden Dolls-Sirene hat nämlich ihr heiß erwartetes Solo-Album am Start. Und „Who Killed Amanda Palmer?” (6) wirkt wie ein aufreizender Nostalgie-Trip in vergangene Zeiten. Die Punk-Attitüde der Dolls wurde dabei nur geringfügig gedrosselt und die Stücke entpuppen sich trotz der Unterstützung von Ben Folds am Piano als überraschend forsche Tanzflächenfüller. Zumindest zu Beginn der Scheibe. Da werden absolut keine Anstalten gemacht, sich beim Seitensprung auf allzu gefühlsduselige Gemütszustände einzulassen. Stattdessen wird mal so richtig Dampf abgelassen. Die Nacht zum Tag gemacht.  Und anschließend dann zurückgelehnt und das Erlebte reflektiert. Hier liegt dann allerdings auch der Schwachpunkt dieser Scheibe. Die balladesken, nachdenklichen Momente wirken fast wie eine Stimmungsbremse zwischen solch himmelhochjauchzenden Pop-Etwürfen, wie „Oasis“. Am Ende überwiegt allerdings trotzdem das positive Gesamtbild. Vor allem deshalb, weil der wunderbare Song „The Point Of It All“ dann doch noch vormacht, wie man ein balladeskes Stück imposant arrangiert. Womit wir dann auch schon bei einer Parallele zum „King Of Pop“ (3) angekommen wären. Dessen Balladen fielen ja auch immer ziemlich ab im Gegensatz zu seinen waghalsigen Tanzflächen-Smashern Marke „Billie Jean“, „Beat It“, „Scream“ oder „Smooth Criminal“. Die betören einen auch heute noch aufgrund ihrer gelungenen und zeitlosen Instrumentierung. Aber „Heal the world“ und „Earth song“? Mal im Ernst… die kannst du heutzutage doch nicht mal mehr im Mainstream-Radio laufen lassen. Am Ende beleben sie dann auch noch diesen unsäglichen „Free Willy“ wieder. Oder „Kevin allein zu Haus“ fühlt sich dazu berufen, einen erneuten Anlauf als Schauspieler zu starten. Womit dann auch schon das Problem dieser Best-Of-Compilation aus dem
Und anschließend dann zurückgelehnt und das Erlebte reflektiert. Hier liegt dann allerdings auch der Schwachpunkt dieser Scheibe. Die balladesken, nachdenklichen Momente wirken fast wie eine Stimmungsbremse zwischen solch himmelhochjauchzenden Pop-Etwürfen, wie „Oasis“. Am Ende überwiegt allerdings trotzdem das positive Gesamtbild. Vor allem deshalb, weil der wunderbare Song „The Point Of It All“ dann doch noch vormacht, wie man ein balladeskes Stück imposant arrangiert. Womit wir dann auch schon bei einer Parallele zum „King Of Pop“ (3) angekommen wären. Dessen Balladen fielen ja auch immer ziemlich ab im Gegensatz zu seinen waghalsigen Tanzflächen-Smashern Marke „Billie Jean“, „Beat It“, „Scream“ oder „Smooth Criminal“. Die betören einen auch heute noch aufgrund ihrer gelungenen und zeitlosen Instrumentierung. Aber „Heal the world“ und „Earth song“? Mal im Ernst… die kannst du heutzutage doch nicht mal mehr im Mainstream-Radio laufen lassen. Am Ende beleben sie dann auch noch diesen unsäglichen „Free Willy“ wieder. Oder „Kevin allein zu Haus“ fühlt sich dazu berufen, einen erneuten Anlauf als Schauspieler zu starten. Womit dann auch schon das Problem dieser Best-Of-Compilation aus dem  Hause Jackson benannt wäre. Wozu? Wer braucht dieses Album? Die zwei Bonus Tracks „Got The Hots“ und der „Thriller-Megamix“ sind beileibe nicht so wundersam, dass man sie anno 2008 noch mal neu aufwärmen müsste. Und den Rest kennen die Fans ja eh schon von den zahlreichen anderen Compilations, die der gerade 50 gewordenen Megastar in den letzten Jahren so rausgehauen hat. Die Verpackung wirkt zudem dermaßen lieblos zusammengebastelt, dass man sich am Ende fragt, ob da nicht mancher Käufer lieber seine alten Cds zusammenkramt und sich anschließend selbst eine Best-Of-Hülle bastelt. Michael Jackson ist zweifelsohne einer der wichtigsten Künstler der Popgeschichte gewesen. Und die Songs auf dieser Compilation über weite Strecken über alle Zweifel erhaben. Die Art ihrer Verbreitung ist allerdings ebenso zweifelhaft, wie die Qualität seiner letzten Platte „Invincible“. Was die Hoffnung nicht gerade erhöht, dass er in Zukunft noch mal im Stande ist, das Ruder herum zu reißen. Stellt sich also nur die Frage: „Do You Remember. How It All Began. It Just Seemed Like Heaven. So Why Did It End?” Man kann die Zeit eben nicht zurück drehen. Und deshalb widmen wir uns zum Abschluss noch mal einen schicken Punkcombo, die bereits im letzten Jahr ein tolles Konzert im Würzburger Jugendkulturhaus Cairo hinlegte. Die Rede ist natürlich von The Gaslight Anthem. Die haben jetzt endlich ihr neues Brett namens „The ´59 Sound“ (6) rausgehauen und klingen dabei erst mal sonderbar unaufdringlich. Die Musik der Jungs ist zweifelsohne poppiger geworden. Man könnte sogar fast von Soul-Punk
Hause Jackson benannt wäre. Wozu? Wer braucht dieses Album? Die zwei Bonus Tracks „Got The Hots“ und der „Thriller-Megamix“ sind beileibe nicht so wundersam, dass man sie anno 2008 noch mal neu aufwärmen müsste. Und den Rest kennen die Fans ja eh schon von den zahlreichen anderen Compilations, die der gerade 50 gewordenen Megastar in den letzten Jahren so rausgehauen hat. Die Verpackung wirkt zudem dermaßen lieblos zusammengebastelt, dass man sich am Ende fragt, ob da nicht mancher Käufer lieber seine alten Cds zusammenkramt und sich anschließend selbst eine Best-Of-Hülle bastelt. Michael Jackson ist zweifelsohne einer der wichtigsten Künstler der Popgeschichte gewesen. Und die Songs auf dieser Compilation über weite Strecken über alle Zweifel erhaben. Die Art ihrer Verbreitung ist allerdings ebenso zweifelhaft, wie die Qualität seiner letzten Platte „Invincible“. Was die Hoffnung nicht gerade erhöht, dass er in Zukunft noch mal im Stande ist, das Ruder herum zu reißen. Stellt sich also nur die Frage: „Do You Remember. How It All Began. It Just Seemed Like Heaven. So Why Did It End?” Man kann die Zeit eben nicht zurück drehen. Und deshalb widmen wir uns zum Abschluss noch mal einen schicken Punkcombo, die bereits im letzten Jahr ein tolles Konzert im Würzburger Jugendkulturhaus Cairo hinlegte. Die Rede ist natürlich von The Gaslight Anthem. Die haben jetzt endlich ihr neues Brett namens „The ´59 Sound“ (6) rausgehauen und klingen dabei erst mal sonderbar unaufdringlich. Die Musik der Jungs ist zweifelsohne poppiger geworden. Man könnte sogar fast von Soul-Punk sprechen. Jedenfalls scheint die Band sich endgültig dazu entschieden zu haben, jetzt doch nicht das Erbe von Hot Water Music anzutreten. Stattdessen sonnen sie sich lieber eine Runde unter Palmen. Werfen dabei mit Hooklines um sich und entwerfen dabei so facettenreiche, wie hymnische Tanzflächenfüller. Dass das Ganze dabei immer wieder in pathetische Gefilde abdriftet, kann man ihnen am Ende vielleicht ankreiden. Aber wen juckt das schon, wenn sich am Ende alle schweißüberströmt im Arm liegen. Dementsprechend. Viel Spaß beim Feiern der letzten Sonnenstrahlen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
sprechen. Jedenfalls scheint die Band sich endgültig dazu entschieden zu haben, jetzt doch nicht das Erbe von Hot Water Music anzutreten. Stattdessen sonnen sie sich lieber eine Runde unter Palmen. Werfen dabei mit Hooklines um sich und entwerfen dabei so facettenreiche, wie hymnische Tanzflächenfüller. Dass das Ganze dabei immer wieder in pathetische Gefilde abdriftet, kann man ihnen am Ende vielleicht ankreiden. Aber wen juckt das schon, wenn sich am Ende alle schweißüberströmt im Arm liegen. Dementsprechend. Viel Spaß beim Feiern der letzten Sonnenstrahlen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// von Alexander Nickel-Hopfengart
UND WAS NUN?