So schnell kann das gehen. Der Zuckerbeat wird fünfzig und passend dazu starten wir mit einem echten Brett in die Nacht. Mongrel jedenfalls sind so eine Art Best Of Kollektion lieb gewonnener Hipsters bestehend aus Reverend And the Makers Frontman John McClure, dessen Bandkollegen Joe Moskow, Arctic Monkeys Schlagzeuger Matt Helders an den Sticks, Ex-Monkeys Bassist Andy Nicholson, Babyshambles Bassist Drew McConnell und dem Londoner Rapper Lowkey. Nach so viel Namedropping, was soll da bitte noch schief gehen? Natürlich nichts. Jedenfalls ist mir seit dem Debüt der Gorillaz kein so bunter Haufen stilvoll geschraubter Tracks mehr untergekommen, der den Zeitgeist in all seinen Facetten treffender wieder spiegeln würde. Grime, HipHop und die alte Dame Indie packen dich zärtlich am Arm und tanzen fröhlich im Kreis. Daraus entsteht ein modernes Musical, das gekonnt alle Facetten der einzelnen Akteure ausleuchtet, wie Werbefotografieren. Nur wird hier nicht nur fröhlich an der glatten Oberfläche gekratzt, bis man sich genötigt sieht, dieses musikalische Experiment als Blaupause eines zeitgemäßen britischen Soundentwurfs zu bezeichnen. Die Grenzen zwischen den Genres lösen sich auf. Scheiben zerspringen. Das Knurren des Basses schält sich seinen Weg aus den pulsierenden Boxen deiner Anlage. Irgendwo zwischen dem letzten Tune vom ebenfalls grandiosen Jamie T. und den wunderbaren Wortspielen von Mastermind Wiley schlüpfen Mongrel in die Rolle des gemeinen Bastards, der sich nicht für einen bestimmten Stil entscheiden möchte. Statt die Hauptstraße zu nehmen wird fröhlich auf den Feldweg abgebogen und ordentlich die Landschaft umgepflügt. Musikalisch gesehen konnte das neue Jahr also kaum besser beginnen, als mit diesem sechsköpfigen Monster aus der Zeitgeist-Tonne. Bleibt nur zu hoffen, dass sich dieses musikalische Phantasialand nicht direkt nach dem Release wieder auflöst. Das wäre ja zu schade. Denn Alben wie „Better Than Heavy“ muss man derzeit mit der Lupe suchen.
Etwas weniger vielschichtig, aber keineswegs spannungsarm gestaltet sich das neue Album von Wintersleep. Das Album von Paul Murphy vereint auf seinen zwölf Songs das schönste aller musikalischen Welten von Thom Yorke über Morrissey bis hin zu Nick Drake und Mark Lanegan. Nach dem zahmen Auftakt liegt man „Welcome To The Night Sky“ spätestens zu Füßen, wenn die ersten Akkorde des tanzbaren Schmachtfetzens „Archaeologists“ aus den Boxen dröhnen. Da fangen ganze Tanzflächen an zu flennen. Oder ist das der Regen? Ne, mal in „echt“ jetzt. Ich bin dieser Musik einfach nur verfallen, obwohl ich mich selbst gar nicht so sehr als Melancholiker sehe. Textlich ist das Ganze aber so dermaßen ergreifend, dass man sich immer wieder wundert, in welch treffende Bilder er die ganz großen Gefühle zu fassen vermag…
“I used to dream about saving the world
Now i just dream about the holidays
I used to write so many songs for my girl
Now i just dream about floating away
I think I need a big vacation
Out of this place”
Den Rest besorgt die Musik. Dieses Piano, das den Songs immer wieder seinen Stempel aufdrückt, als wäre die Platte ein privater Club zu dem man nur ganz allein Zutritt hat. Schade eigentlich, dass der Winter fast vorbei ist. Aber für den Frühling gibt’s ja auch schon den passenden Soundtrack aus Fat Wreck-Hausen.
Die Melody-Punker von The Loved Ones legen mit ihrer EP „Distractions“ geradezu einen Befreiungsschlag aus der zweiten Reihe hin. Songs, wie „Distracted“ sind dabei weitaus mehr, als nur potenzielle Filler, um das Festivaltape bis oben hin voll zu kriegen. Nein. Ein Track wie dieser gehört auf die Pole Position. Jedenfalls wird hier mit einer solchen Melodiedichte gearbeitet, dass sich Alkaline Trio und No Use For A Name schon mal warm anziehen dürfen. Wie ein gekonnter Grenzgänger zwischen diesen beiden Acts klettern The Loved Ones kurzerhand aufs Zollhäuschen und rocken alle, die ihnen vor die Linse laufen. Ich jedenfalls hab jetzt schon meine potenzielle Lieblings-EP für den Sommer gefunden.
Und freu mich hinterher, wie ein Spiderschwein, dass Fiva MC endlich wieder ihre Intrigen spinnt. Raptechnisch macht ihr hierzulande ja sowieso kaum jemand etwas vor. Schon auf den beiden Vorgängern „Spiegelschrift“ und „Kopfhörer“ etablierte sie sich als so etwas, wie ein weiblicher Dendemann. Auch „Rotwild“ kann da durchaus mithalten, auch wenn sie ihren klassischen Rap-Sound ein bisschen hoch getunt hat. Verantwortlich dafür zeichnet sich der herzallerliebste Flip von den sympathischen Österreichern Texta. Der verleiht den Tracks ein zeitgemäßes, aber niemals austauschbares Soundgewand. Textlich bewegt sich Fiva derweil nach wie vor abseits jeglicher Klischees, die sich hie und da so breit gemacht haben. Sie erzählt lieber Geschichten aus dem Leben. Übers Erwachsenwerden. Über die Liebe. Und steht damit für den romantischen Ansatz von Rap, wie ihn Doppelkopf einst unter die Leute brachten. Dass sich dabei das ein oder andere Soul Sample in ihrem Sound schleicht, wirkt da nur konsequent. Schließlich versucht da jemand ganz bewusst nach der Seele zu greifen, die sonst vom Blitzlicht des roten Teppichs aufgesogen wird.
Ziemlich brachial schwappt hinterher ein hipper Act aus dem lieben London zu uns hinüber. The Qemists sind so etwas, wie die gelungenere Variante des kürzlich erschienenen Pendulum-Debüts. Mit ihren treibenden Gitarrenriffs machen dir die Jungs zusammen mit einigen Gaststars, wie dem allseits beliebten Mike Patton ordentlich Dampf unter der Haube. Im neuen Look wird dann so lange das Grenzgebiet zwischen Drum´n´Bass und Elektro umschifft, bis man sich schweißüberströmt ins Moshpit wirft. Diese Scheibe ist wie geschaffen, um sich vollends seiner Kleidung zu entledigen und dürfte gerade in Zeiten, wo Hadouken allerorts für Jubelstürme sorgen für reichlich Akzeptanz auf dem Dancefloor sorgen. Besonders beeindruckend ist dabei vor allem die Kollaboration mit Grime-Godfather Wiley geraten, die so dermaßen drückt, dass man sich fühlt, als wäre gerade nochmal 1991. Alles in allem ein ebenso schriller wie gelungener Elektro-Mix, der sich auch nicht scheut seinem Hang zur Luftgitarre-Pose nachzugeben.
Solltet ihr dann hinterher etwas außer Puste sein, nutzt doch die Gelegenheit und zieht euch den durchweg gelungenen Streifen „Berlin Calling“ rein. Selten erschienen Club und Psychiatrie in solch inniger Liebe miteinander verpendelt und mit den zeitweise wirklich traumhaften Szenen aus der Berliner Szene-Dramödie kickt der dazu passende Soundtrack von Paul Kalkbrenner gleich noch mal doppelt so gut. Man sieht es immer wieder bildlich vor sich, wie der Protagonist zu seiner Mucke die halbe Station in seinen persönlichen Spielplatz umfunktioniert und dabei von einem Fettnäpfchen ins Nächste trampelt, ohne dass man ihm Böses unterstellen möchte. Solch herzensgute, der Musik verfallene Menschen trifft man schließlich nicht alle Tage. Umso besser, dass man das Ganze nun auch noch mal auf Albumlänge nacherleben darf. Die Musik ist dabei wie geschaffen, um sich wie ein hypnotischer Schleier auf dem Gemüt des Hörers auszubreiten. „Azure“ ist die vielleicht schönste Elektroballade des ausklingenden Winters und wenn in „Sky And Sand“ immer wieder ein sanftes Stoßgebet gen Himmel geschickt wird, dass ungefähr so klingt…
“In the night time when the world is at it’s rest.
You will find me. In the place I know the best.
Dancin‘ shoutin‘. Flying to the moon.
Don’t have to worry. ‚Cause I’ll be come back soon.“
Dann ja dann ist man ganz nah dran an dem Gefühl, welches elektronische Musik in ihren besten Momenten zu vermitteln vermag. Dann nämlich konserviert Kalkbrenner diesen hoffnungslos romantischen Moment, wenn man morgens um sechs zum ersten Mal nach Stunden der Ekstase die Augen öffnet und einfach nur dem Zauber des Moments verfällt.
Der wird hinterher dann von All The Saints wieder in kleine Stücke gerissen. Ihre Musik fühlt sich an wie ein schwereloses Wandeln zwischen zwei gegensätzlichen Polen. Die Postrock-Phantasien der Band schwingen sich mal bedrohlich auf, ebben dann aber wieder genügsam ab. Am Ende reibt man sich verwundert die Augen, wie es diese Musik schafft, nicht ins Klischeehafte zu gleiten. Stattdessen ist man hingerissen von einem so überraschend poppigen Moment zu Beginn von „Papering Fix“, der all das in sich vereint, was Minus The Bear so wunderbar macht. Dabei aber dennoch ordentlich auf die Tube drückt. Um wirklich wegweisend zu sein, kommt „Fire On Corridor X“ dabei vielleicht ein paar Jahre zu spät, dennoch hab ich mich von solch zauberhafter Postrockmantik, wie sie das beinahe akustische „Leeds“ ausstrahlt, schon lange nicht mehr unterhalten gefühlt.
Wer sich jetzt dann so richtig eingejammt hat, sollte sich hinterher mal das neue Album von These Arms Are Snakes zu Gemüte führen. „Tail Swallower And Dove“ macht sich ja gerade so ein bisschen daran, die Spitze des Postrock Hypes zu erklimmen. Dabei haben Bands, wie At The Drive-In und Konsorten sicher einen nachhaltigen Einfluss hinterlassen. Trotzdem bleiben die Jungs ihrer Linie treu und schreddern ihre Gitarren immer so lange durch den Metal-Wolf, dass das Ganze nicht zu glatt gebügelt rüber kommt. Alles in allem haben sie damit mal wieder einen ziemlich ambitionierten Tune erschaffen, der gerade in den Momenten, wo er nicht so aufgeblasen wirkt, seinen einzigartigen Charme entfaltet. Alles in allem sicher kein einfaches Werk. Für Menschen, die das entsprechende Maß an Zeit mitbringen aber durchaus eine Erfahrung, die sich, wie zuletzt bei Opeth, als durchaus nachhaltig erweist.
Schön, dass hinterher dann geradezu schmissig ein gewisser ClickClickDecker mit neuen Album am Start ist. Der Vorgänger wurde ja ziemlich ignoriert vom Mainstream. Klang vielleicht doch eine Spur zu leichtfüßig für die Tomte/Kettcar-Fraktion. Und wenn man sich sein gelungenes Side-Projekt Bratze mal reinzieht, muss man ehrlich zugeben: dem ersten Album fehlte vielleicht alles in allem einfach der ein oder andere Aha-Effekt, der die Songs nachhaltig ins Gedächtnis eingräbt. Nun ist es nicht gerade so, als würde sich „Den Umständen entsprechend“ mit hymnischen Refrains anbiedern. Ganz im Gegenteil. Seine wahre Stärke liegt in den Zwischentönen. Und Songs, wie das äußerst schmissig dahin gerotzte „Händedruck am Wendepunkt“ sollten diesmal auch dafür sorgen, dass sich das Ganze auf die Indie Disco-Tanzflächen verirrt. Zudem könnte seine Musik all jenen eine Bleibe bieten, welche den zuletzt eingeschlagenen Weg von Kettcar nicht mehr ganz folgen konnten. Alles in allem ist ClickClickDecker damit vielleicht immer noch eine Spur zu zahm für den großen Erfolg. Aber wen interessiert das schon in Momenten, in denen man sich zu Sätzen, wie „was kann es Beschisseneres geben, wenn du die Freiheit hast zu gehen und trotz allem wieder bleibst“ unter die Bettdecke verziehst.
Womit wir uns auch schon wieder dem Ende nähern. Aber nicht ohne uns vorher noch mal von Mando Diao die volle Breitseite in Form von gitarrenlastiger Glückseligkeit reinpfeffern zu lassen. Auf „Give Me Fire“ geht es zwar etwas gemächlicher zu, als auf dem vorherigen Output der Band. Aber mit einem Stampfer, wie „Dance With Somebody“ haben die Jungs dafür die Chance sich für immer im hellen Schein des Disco-Blitzlichts zu suhlen. Ein wunderschönes Lied, das nur noch getoppt wird vom famosen Auftakt namens „Blue Lining White Trenchcoat“. Überhaupt wurde der Hitappeal im Gegensatz zum leider verschmähten, aber durchaus passablen Vorgänger wieder weiter nach oben geschraubt. Und so sieht man sich schon berauscht durch die Bude turnen, während die Jungs sich zum Ragtime-Rock von „Mean Streets“ ein sympathisches „Take My Hand And Close Your Pretty Eyes“ abringen. Oder wenn sie im potentiellen Megahit „Gloria“ ein hoffnungslos schönes „Gloria´s One Day Ahead Watching You From The Heaven´s Gate“ abfeuern. Dann ist es wahrlich nicht mehr weit hin zu den Himmelspforten. Also macht es mal jut. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
 So schnell kann das gehen. Der Zuckerbeat wird fünfzig und passend dazu starten wir mit einem echten Brett in die Nacht. Mongrel jedenfalls sind so eine Art Best Of Kollektion lieb gewonnener Hipsters bestehend aus Reverend And the Makers Frontman John McClure, dessen Bandkollegen Joe Moskow, Arctic Monkeys Schlagzeuger Matt Helders an den Sticks, Ex-Monkeys Bassist Andy Nicholson, Babyshambles Bassist Drew McConnell und dem Londoner Rapper Lowkey. Nach so viel Namedropping, was soll da bitte noch schief gehen? Natürlich nichts. Jedenfalls ist mir seit dem Debüt der Gorillaz kein so bunter Haufen stilvoll geschraubter Tracks mehr untergekommen, der den Zeitgeist in all seinen Facetten treffender wieder spiegeln würde. Grime, HipHop und die alte Dame Indie packen dich zärtlich am Arm und tanzen fröhlich im Kreis. Daraus entsteht ein modernes Musical, das gekonnt alle Facetten der einzelnen Akteure ausleuchtet, wie Werbefotografieren. Nur wird hier nicht nur fröhlich an der glatten Oberfläche gekratzt, bis man sich genötigt sieht, dieses musikalische Experiment als Blaupause eines zeitgemäßen britischen Soundentwurfs zu bezeichnen. Die Grenzen zwischen den Genres lösen sich auf. Scheiben zerspringen. Das Knurren des Basses schält sich seinen Weg aus den pulsierenden Boxen deiner Anlage. Irgendwo zwischen dem letzten Tune vom ebenfalls grandiosen Jamie T. und den wunderbaren Wortspielen von Mastermind Wiley schlüpfen Mongrel in die Rolle des gemeinen Bastards, der sich nicht für einen bestimmten Stil entscheiden möchte. Statt die Hauptstraße zu nehmen wird fröhlich auf den Feldweg abgebogen und ordentlich die Landschaft umgepflügt. Musikalisch gesehen konnte das neue Jahr also kaum besser beginnen, als mit diesem sechsköpfigen Monster aus der Zeitgeist-Tonne. Bleibt nur zu hoffen, dass sich dieses musikalische Phantasialand nicht direkt nach dem Release wieder auflöst. Das wäre ja zu schade. Denn Alben wie „Better Than Heavy“ muss man derzeit mit der Lupe suchen.
So schnell kann das gehen. Der Zuckerbeat wird fünfzig und passend dazu starten wir mit einem echten Brett in die Nacht. Mongrel jedenfalls sind so eine Art Best Of Kollektion lieb gewonnener Hipsters bestehend aus Reverend And the Makers Frontman John McClure, dessen Bandkollegen Joe Moskow, Arctic Monkeys Schlagzeuger Matt Helders an den Sticks, Ex-Monkeys Bassist Andy Nicholson, Babyshambles Bassist Drew McConnell und dem Londoner Rapper Lowkey. Nach so viel Namedropping, was soll da bitte noch schief gehen? Natürlich nichts. Jedenfalls ist mir seit dem Debüt der Gorillaz kein so bunter Haufen stilvoll geschraubter Tracks mehr untergekommen, der den Zeitgeist in all seinen Facetten treffender wieder spiegeln würde. Grime, HipHop und die alte Dame Indie packen dich zärtlich am Arm und tanzen fröhlich im Kreis. Daraus entsteht ein modernes Musical, das gekonnt alle Facetten der einzelnen Akteure ausleuchtet, wie Werbefotografieren. Nur wird hier nicht nur fröhlich an der glatten Oberfläche gekratzt, bis man sich genötigt sieht, dieses musikalische Experiment als Blaupause eines zeitgemäßen britischen Soundentwurfs zu bezeichnen. Die Grenzen zwischen den Genres lösen sich auf. Scheiben zerspringen. Das Knurren des Basses schält sich seinen Weg aus den pulsierenden Boxen deiner Anlage. Irgendwo zwischen dem letzten Tune vom ebenfalls grandiosen Jamie T. und den wunderbaren Wortspielen von Mastermind Wiley schlüpfen Mongrel in die Rolle des gemeinen Bastards, der sich nicht für einen bestimmten Stil entscheiden möchte. Statt die Hauptstraße zu nehmen wird fröhlich auf den Feldweg abgebogen und ordentlich die Landschaft umgepflügt. Musikalisch gesehen konnte das neue Jahr also kaum besser beginnen, als mit diesem sechsköpfigen Monster aus der Zeitgeist-Tonne. Bleibt nur zu hoffen, dass sich dieses musikalische Phantasialand nicht direkt nach dem Release wieder auflöst. Das wäre ja zu schade. Denn Alben wie „Better Than Heavy“ muss man derzeit mit der Lupe suchen.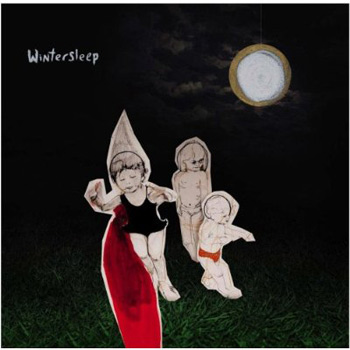 Etwas weniger vielschichtig, aber keineswegs spannungsarm gestaltet sich das neue Album von
Etwas weniger vielschichtig, aber keineswegs spannungsarm gestaltet sich das neue Album von  Die Melody-Punker von
Die Melody-Punker von  Und freu mich hinterher, wie ein Spiderschwein, dass
Und freu mich hinterher, wie ein Spiderschwein, dass  Ziemlich brachial schwappt hinterher ein hipper Act aus dem lieben London zu uns hinüber.
Ziemlich brachial schwappt hinterher ein hipper Act aus dem lieben London zu uns hinüber.  Solltet ihr dann hinterher etwas außer Puste sein, nutzt doch die Gelegenheit und zieht euch den durchweg gelungenen Streifen „Berlin Calling“ rein. Selten erschienen Club und Psychiatrie in solch inniger Liebe miteinander verpendelt und mit den zeitweise wirklich traumhaften Szenen aus der Berliner Szene-Dramödie kickt der dazu passende Soundtrack von
Solltet ihr dann hinterher etwas außer Puste sein, nutzt doch die Gelegenheit und zieht euch den durchweg gelungenen Streifen „Berlin Calling“ rein. Selten erschienen Club und Psychiatrie in solch inniger Liebe miteinander verpendelt und mit den zeitweise wirklich traumhaften Szenen aus der Berliner Szene-Dramödie kickt der dazu passende Soundtrack von 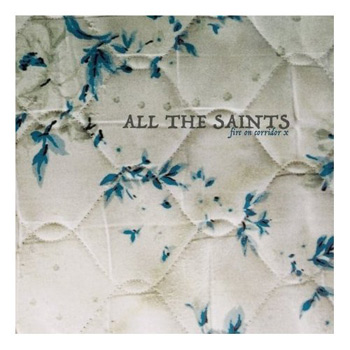 Der wird hinterher dann von
Der wird hinterher dann von  Wer sich jetzt dann so richtig eingejammt hat, sollte sich hinterher mal das neue Album von
Wer sich jetzt dann so richtig eingejammt hat, sollte sich hinterher mal das neue Album von 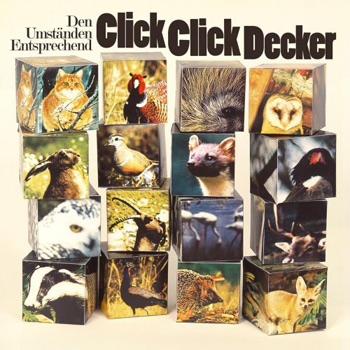 Schön, dass hinterher dann geradezu schmissig ein gewisser
Schön, dass hinterher dann geradezu schmissig ein gewisser  Womit wir uns auch schon wieder dem Ende nähern. Aber nicht ohne uns vorher noch mal von
Womit wir uns auch schon wieder dem Ende nähern. Aber nicht ohne uns vorher noch mal von
UND WAS NUN?