Verdammt. Die Herbstmelancholie-Vernichtungs-Hymne „Pale Bride“ hat es ja bereits angedeutet. The Von Bondies werden mit ihrem neuen Album „Love, Hate, And Then There´s You“ endlich den Ruhm einfahren, der ihnen gebührt. Schon der Opener „This Is Our Perfect Crime“ stürmt los, als wollte man -getarnt als fette Sternschnuppe- mal eben durch die Welt der „Rockstars“ rasen, wie Grünflächen. Dass sie am Ende nicht verpuffen, wie Rotlichtviertel, ist vor allem den nachhaltigen Tracks auf Hälfte zwei geschuldet. Die halten zwar dem euphorischen Gebrüll zu Beginn nicht stand, wagen aber den einen oder anderen Seitensprung in „poppige“ Gefilde. Dabei laufen die Jungs nie Gefahr mit den Reichen und Berühmten in der Kiste zu landen (wie erst kürzlich die Kings Of Leon), sondern verharren in ehrfürchtiger Pose vor dem eigenen Schaffen. Soll heißen: Anbiederung an den Mainstream wird hier durch Eindreschen auf die verzerrte Klampfe ausgeschlossen. Stattdessen wirbeln die Jungs ordentlich Staub auf und brettern durch einen Nebelschleier auf die großen Bühnen des Landes.
Olli Schulz war ja während dessen schon immer ein wesentlich größerer Entertainer, als Sänger – auch wenn er sich mit seinem neuen Album „Es brennt so schön“ durchaus anschickt diese Distanz zu verringern. Schon der Opener „Ab jetzt tut´s nur noch weh“ nimmt einen gefangen mit seinen Punchlines. Da haben die Jungs von Razzia ihre Spuren hinterlassen, denen er ja mit einer schicken Vinyl-EP erst kürzlich ein musikalisches Denkmal setzte. Der Rest der Platte bewegt sich dann immer auf dem schmalen Grad zwischen Schunkel-Pop („Geheimdienst“), musikalischem Missgeschick („All You Can Eat“) und Sommerhymne (das Bundesvision Song Ballermann Dingsda „Mach den Bibo“). Am Ende bleibt vor allem hervor zu heben, dass es Olli noch nie gelungen ist so viele Facetten seiner musikalischen Vorlieben auf einem Album zu vereinen. Dass da auch der eine oder andere Track in die Hose geht, ist dann auch sofort verziehen. Vor allem wegen des charmanten Belle & Sebastian-Gedächtnis-Artworks. Das brennt so schön. Ne, nur ´n Scherz.
Ziemlich lustig sind auch Peter Bjorn und John drauf. Und die scheinen auf ihrem neuen Album „Living Thing“ mal wieder Lust auf Popmusik bekommen zu haben. Mit astreinen Hits, wie „It Don´t Move Me“ und „Just The Past“ zerren sie dich in den aufgeheizten Club. Dort werden dann verquere Böller a la „Lay It Down“ und „Living Thing“ gezündet und die Regler verschraubt, bis die bunten Lichter fröhlich im Takt blinken. Die Tracks wirken niemals platt, aber auch nicht überambitioniert. Musikalische Experimentierfreude trifft auf Hitappeal. Und all das wirkt ungemein schlüssig zusammen geschraubt, wie Dauerwellen. Immer wieder ist man überrascht, wie aus dem Durcheinander eigentlich ein so homogenes Bild entstehen kann. Fast scheint es, als hätten die Beiden erst ein akustisches Klanggebilde entworfen, es dann in kleine Puzzleteile zerlegt und anschließend wieder zusammengesetzt. Daraus entspringt ein brüchiger Popentwurf, der wirkt wie ein schönes Gemälde mit einem Sprung im Rahmen. Fazit: Es sind doch immer wieder die kleinen Fehlbarkeiten, die eine Sache wirklich interessant machen. Und dieses Album strotzt nur so davon.
Selig waren derweil ja schon in den 90ern dick im Geschäft – doch während die musikalischen Ansprüche stiegen, sank leider die Publikumsakzeptanz. Dabei war ihr drittes Album „Blender“, das den Untergang der Band einläutete, doch ein famoses Meisterwerk. Eine Schleierwolke durchzog die bezaubernden Melodien und katapultierte die Band endgültig aus der Umlaufbahn des Deutschrocks. Wenn nun also fröhlich reformiert wird, stellt sich die Frage: Welche Version von Selig bekommt man denn nun? Die Antwort ist schnell gefunden. Selig stürzen sich mit „Und endlich unendlich“ auf ihr musikalisches Frühwerk, kurz gesagt: die erfolgreiche Schaffensphase. Es ist aber so, dass die Platte trotzdem funktioniert. Sänger Jan Plewka säuselt die üblichen Verdächtigen von Lindenberg bis Clueso mal eben mit links an die Wand. „Traumfenster“ ist zum Beispiel eine hoffnungsvolle Hymne auf das Leben und die Liebe, die ohne eine Spur von Kitsch auskommt. „Schau schau“ wiederum ist das offizielle 2009er Update von „Wenn ich wollte“. Und auch der Rest der Scheibe strotzt nur so vor tiefsinnigen und gefühlvollen Knallern, die sich direkt an die Verse des melancholischen Rio Reiser heften. „Und endlich unendlich“ ist in Zeiten gleichförmigen Chartpops Marke Revolverheld oder Silbermond ein Glücksfall für die hiesige Musiklandschaft. Ein gelungenes Comeback, das wirkt wie ein Versprechen, dass da bald noch Großes auf uns zukommt.
Und verdammt noch mal, schon wieder dieser Lärm. Kirmes-Elektro mit Ballermann-Attitüde hat ja seit Deichkind und Justice wieder breite Zustimmung gefunden. Ist doch klar, dass da einer wie Der Tante Renate nicht groß an seinem Spezialgebiet feilt. Und das heiß nun mal: Regler hoch und abgehen. Nach dem grandiosen Sidekick mit Bratze folgt nun also der nächste Streich aus dem Hause Norman Kolodziej. „Splitter“ heißt er und verwandelt man wieder alle Weihnachtsbäume in Aschehäufchen. Der Blitzlicht-Roboter aus dem NuRave-Wunderland macht mal wieder Elektrogewitter bis es brennt. Und man bekommt mit zunehmender Lauflänge immer wieder das Gefühl, er hätte noch nie so aggressiv geklungen. Alles pumpt so brachial nach vorne, dass man sich wünscht, da käme mal etwas Dynamik ins Spiel. Im Club mag das ja zu wahren Euphoriestürmen einladen, was da aus den Boxen walzt. Aber im heimischen Wohnzimmer, da hätte man sich mehr Tracks, wie das famose „Becknacktodrom“ (featuring Saalschutzs Mt Dancefloor) gewünscht. Da wird zwar auch auf gesangliche Unterstützung verzichtet, aber zumindest Marke frühen Prodigy und Konsorten gesampelt, bis die Sterne vom Himmel purzeln und alles in einem einzigen grellen Lichtstrahl versinkt. Wer auf die fette Party aus ist, sollte diese Scheibe mal anchecken!
Und verdammt noch mal. „What´s So Bad About Feeling Good“? Diese berechtigte Frage stellt auch Ben Lee im Opener seines neuen Albums “The Rebirth Of Venus”. Eigentlich müsste man ihm ja jetzt zurufen, dass er sich was schämen soll – solche glatt polierten Schmachtfetzen hier raus zu hauen. Das kann doch nicht sein ernst sein. Radiopop gibt’s doch schon genug. Aber warum pfeif ich denn jetzt schon wieder mit? Warum hängt mir der zuckersüße Refrain von „I Love Pop Music“ schon seit Stunden im Ohr? Warum kann ich nicht anders, als den lieben langen Tag „Surrender“ vor mir her zu summen, wie Bienenwaben. Woher nimmt der Junge nur all die Melodien, die da im Raum verhallen, wie die Silhouetten eines schönen Traums. Zu dieser Musik kann man gar nicht anders, als beschwingt mit dem Fuß zu wippen. Anfangs wehrt man sich noch dagegen. Versucht sich in die Ecke zu verkriechen und weiß, dass man sich in einem Jahr dafür schämen wird, diese Scheibe jemals gut gefunden zu haben. Aber jetzt – just in diesem Moment. Mit der Frühlingssonne vor Augen. Da krallt sich die Scheibe fest, wie Katzenpfoten. Wenn du also immer noch auf der Suche nach deiner Popspritze für den Frühling bist? Hier hast du sie… Schiebedach auf, Regler nach oben und auf zum Baggersee…
… und wenn dann doch mal eine Wolke aufzieht, kann man ja immer noch rüber schalten zu Nina Persson und dem zweiten Album ihres Side-Projekts A Camp. Die Cardigans-Sängerin hat sich eine gefühlte Ewigkeit nach dem beschwingten Hüpfer von Erstling endgültig der Melancholie verschrieben. Trotzdem ist „Colonia“ ein bezauberndes Werk, das durchaus mit dem aktuellen Schaffen ihrer Hauptband mithalten kann. In Songs, wie „Stronger Than Jesus“ und „My America“ übertrifft sie sogar die Erwartungen. Das sind einfach nur ganz große Popsongs. Sterneklar, blitzeblank aber von einer Erhabenheit, wie man sie sich im Pop immer wünscht, wenn Dido und Konsorten ihren gleichförmigen Schmalz aufs Publikum absondern. Hier wird noch gelitten und geliebt. Die Augen werden geschlossen. Das Herz geöffnet. Und das Klimpern der Tasten klingt wie der Soundtrack vom Ende des Regenbogens. Wo die Welt eine andere ist – eine bessere. Wo man noch weiß, wie sich das anfühlt: einfach nur seinen Träumen ausgeliefert zu sein. „Colonia“ wirkt wie ein Gegenentwurf zum grauen Alltag. Wäre Musik eine TV-Serie, „Colonia“ wäre „Regina Regenbogen“.
Wesentlich lärmiger gehen Polar Bear Club hinterher auf ihre Hörerschaft los. Auf ihrem Album „Sometimes Things Just Disappear“ vermengen sie die Gitarrenbreitseite von Rise Against mit der Emotionalität von Blues-Verfechtern der Marke The Gaslight Anthem und The Hold Steady. Verehrer dieses Sounds werden schon nach wenigen Sekunden die Augen schließen und sich vollends der Musik ausliefern. Auch wenn zur Mitte hin der eine oder andere Song den Drive des famosen Auftakts vermissen lässt. Dieses Album gehört mit zum Besten, was gerade auf dem Markt ist. So verkratzt gelitten wurde höchstens noch bei Hot Water Music. Und wer sich immer noch gern den Tag von „Something To Write Home About“ (Get Up Kids) oder „Clumsy“ (Samiam) versüßen lässt, der wird hier einen treuen Begleiter finden – der wird mit der alten Karre über eine einsame Landstraße brettern und die Anlage strapazieren. Und der wird sich Gott verdammt die Seele aus dem Leib schreien, wenn Zeilen, wie „Those Magic Clothes Don´t Play Music“ aus den Boxen strömen. Nur um anschließend laut „We Do“ zurück zu brüllen. Immer und immer und wieder.
Anschließend lehnen wir uns dann zurück. Wippen fröhlich mit den Fußnägeln und freuen uns, dass The View endlich den Frühling einläuten. Hat man sich erstmal durch den verqueren Opener „Typical Time 2“ gewühlt, bekommt man einen wahren Hitreigen vor den Latz geknallt. „Which Bitch?“ dürfte sich im Gegensatz zum Vorgänger diesmal als langlebiger Zeitgenosse erweisen. Strotzt die Scheibe doch nur so vor Hits, während beim Debüt noch so manche Schwächeperiode überbrückt werden musste. „5 Rebbeccas“, „Shock Terror“ und „Temptation Dice“ wird man demnächst auf jedem Rockfestival der Nation zu hören bekommen. Und Tracks, wie „One Off Pretender“ und „Distant Doubloon“ schicken sich an, nach Verglühen des Hitfeuerwerks in den Gehörgängen zu verharren, wie Ohrenhöhler. Wer hätte damit gerechnet? Ich jedenfalls nicht. Dementsprechend begeistert springe ich bereits im Zimmer umher, um endlich mal wieder so richtig abzudrehen.
Danach sollten alle genau hinhören, die sich für ausufernde Gitarrenklänge begeistern. …And You Will Know Us By The Trail Of Dead haben endlich mal wieder ein neues Werk am Start. Und laufen erstmals Gefahr, sich musikalisch zu wiederholen. Versteht mich bitte nicht falsch: ich finde das ganz wunderbar. Ein Update der letzten Scheibe versüßt mir den Tag, wie Gummitiere. Und überhaupt versammelt die Band auf „The Century Of Self“ mal wieder eine ganze Reihe hymnische bis progrockige Gebilde, die sie mit ihren sagenhaften Gitarrenriffs garnieren. Der Popappeal des letzten Albums wurde zwar auf das Nötigste gedrosselt, was die Scheibe insgesamt aber als schlüssige Einheit erscheinen lässt. Zudem schlägt sich das auch in Sachen Langlebigkeit nieder. Hatte man beim Vorgänger noch das Gefühl, dass so mancher Song sich ins alternative Radioformat einschleichen könnte, wird hier kompromisslos dem Größenwahn gefrönt. Der musikalische Zirkus, den die Band hier veranstaltet, entfesselt einen hemmungslosen Reigen an Melodien, der in dem himmelhochjauchzendem „Bells Of Creation“ seinen ultimativen Höhepunkt findet. Und dann steht sie da. Eine Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Und wird sich beim nächsten Album fragen lassen müssen, wie sie das jetzt noch toppen möchte.
Zum Abschluss widmen wir uns noch mal einem schicken Sammelsurium an B-Seiten und anderen Raritäten aus dem Hause Strung Out. In 17 Jahren Bandgeschichte fällt eben so einiges an: Akustisches, Demos, alternative Versionen. All das wurde auf „Prototypes And Painkillers“ zusammen gekarrt und neu aufbereitet. Wer jetzt kritisch anmerkt, dass das doch eigentlich die reine Abzocke ist, dem sei gesagt: auch für Fans der Marke Alleskäufer ist hier noch was dabei. Neben dem bekannten Material werden nämlich noch sieben unveröffentlichte Songs durch die Pipeline gejagt, die das melodie-affine Punkherz höher schlagen lassen. Zudem ist es schon bemerkenswert, dass bei den insgesamt 26 Tracks kaum ein Ausfall zu beklagen ist. Ein schickes Paket also. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
 Verdammt. Die Herbstmelancholie-Vernichtungs-Hymne „Pale Bride“ hat es ja bereits angedeutet.
Verdammt. Die Herbstmelancholie-Vernichtungs-Hymne „Pale Bride“ hat es ja bereits angedeutet. 
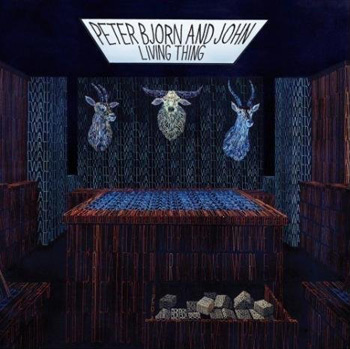 Ziemlich lustig sind auch
Ziemlich lustig sind auch 
 Und verdammt noch mal, schon wieder dieser Lärm. Kirmes-Elektro mit Ballermann-Attitüde hat ja seit Deichkind und Justice wieder breite Zustimmung gefunden. Ist doch klar, dass da einer wie
Und verdammt noch mal, schon wieder dieser Lärm. Kirmes-Elektro mit Ballermann-Attitüde hat ja seit Deichkind und Justice wieder breite Zustimmung gefunden. Ist doch klar, dass da einer wie  Und verdammt noch mal. „What´s So Bad About Feeling Good“? Diese berechtigte Frage stellt auch
Und verdammt noch mal. „What´s So Bad About Feeling Good“? Diese berechtigte Frage stellt auch  … und wenn dann doch mal eine Wolke aufzieht, kann man ja immer noch rüber schalten zu Nina Persson und dem zweiten Album ihres Side-Projekts
… und wenn dann doch mal eine Wolke aufzieht, kann man ja immer noch rüber schalten zu Nina Persson und dem zweiten Album ihres Side-Projekts 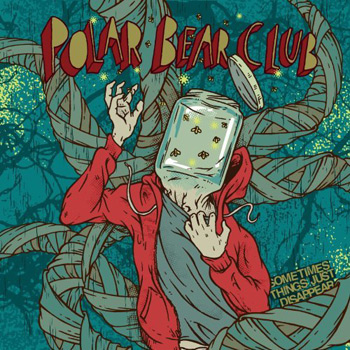 Wesentlich lärmiger gehen
Wesentlich lärmiger gehen  Anschließend lehnen wir uns dann zurück. Wippen fröhlich mit den Fußnägeln und freuen uns, dass
Anschließend lehnen wir uns dann zurück. Wippen fröhlich mit den Fußnägeln und freuen uns, dass 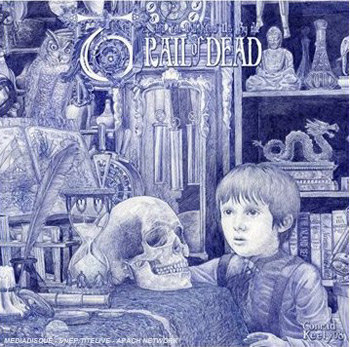 Danach sollten alle genau hinhören, die sich für ausufernde Gitarrenklänge begeistern. …
Danach sollten alle genau hinhören, die sich für ausufernde Gitarrenklänge begeistern. … Zum Abschluss widmen wir uns noch mal einem schicken Sammelsurium an B-Seiten und anderen Raritäten aus dem Hause
Zum Abschluss widmen wir uns noch mal einem schicken Sammelsurium an B-Seiten und anderen Raritäten aus dem Hause
UND WAS NUN?