The Airborne Toxic Event sollte man sich schon mal ganz dick auf die „Muss ich mir mal anhören“-Merkliste kritzeln. Die machen nicht nur „Poetry You Can Dance To“. Nein, die entwerfen auf ihrem gleichnamigen Album auch einen sonderbaren Mix aus The Clash und U2. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil es komischerweise funktioniert und auch noch so unverwechselbar rüber kommt, dass man den Vergleich mit den Vorbildern schon nach wenigen Sekunden wieder in die Tonne kloppt. The Airborne Toxic Event müssen nicht groß aus dem Schatten von Jemandem treten. Die Jungs aus Los Angeles knipsen lieber das Licht aus und säuseln einem aus dem Dunkel der Nacht ihre verzaubernden Melodien ins Ohr. Alle Frühlingsverweigerer und Heuverschnupften werden sie für dieses Album lieben, weil sie sich dazu hervorragend ins Zimmer einschließen können, die Anlage aufdrehen und bei geschlossenen Jalousien wie wild im Kreis springen können. Allein schon das famose „Gasoline“ befeuert die heimische Tanzfläche so herzallerliebst, dass man sich zeitweise fragt, wie sie es immer wieder schaffen mit ihren recht konventionellen Klängen aus der Masse hervor zu preschen, wie Stagediver. Eigentlich hat man solcher Musik doch inzwischen auch die letzte Facette abgetrotzt, die sie mit dem Prädikat „spannend“ versehen könnte. Aber The Airborne Toxic Event kriegen das Kunststück hin, so zu klingen, als hätte ihnen gerade erst jemand eine Gitarre in die Hand gedrückt und gesagt: mach mal, Und dann ist auf einmal etwas so unschuldig Großartiges dabei heraus gekommen, wie dieses Album. Ein brachial melancholischer Brocken der tanzbaren Glückseligkeit. Wie würde Justin Timberlake sagen? Genau… i´m loving it… ich hoffe mich erhört im Gegensatz zu ihm auch jemand.
Was sich die wunderbare Band The Soundtrack Of Our Lives derweil bei der Covergestaltung ihres neuen Albums gedacht hat, wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Jedenfalls: schlimmer geht’s nimmer. Umso schöner zu sehen, dass sie dem ambitionierten Unterfangen, ein Doppelalbum rauszuhauen, einfach mal nachgegeben haben und der geneigte Oasis-Liebhaber auf diese Weise in den Genuss von 24 neuen Stücken für endlose Nächte auf einsamen Landstraßen kommt. So verstrahlt poppig. So charmant. So hymnisch wie TSOOL klingen heute höchstens noch die Doves. Denen geht allerdings dieser leicht pathetische Moment ab, der hier immer wieder im Refrain auf die Spitze getrieben wird und so hinreißend ist, dass alle, von denen sie mal Besitz ergriffen haben, nie wieder von den Melodien dieser Band loskommen. Im Grunde genommen ist „Communion“ dabei nicht groß anders geraten, als die beiden Vorgänger. Eine Spur ausufernder klingt es auf Scheibe eins, auch wenn ein Blick aufs Backcover den Rezensenten gleich wieder Lügen straft. Die Songlänge wurde nämlich konstant auf vier Minuten getrimmt. Den Stücken schadet das nicht. Dennoch sollte man sich die Scheibe schrittweise reinziehen. Stück für Stück entdecken. Dann schwelgt man schon nach wenigen Tagen im siebten Rockmusikhimmel. Vor allem Scheibe zwei hat so dermaßen viel Hitappeal, dass man gar nicht weiß, welchen Schunkelrocker man als erstes anstupsen soll. Das wahrscheinlich schönste, altmodischste, selbst verliebteste, pathetischste, herzallerliebste, sympathischste, ergreifendste Zahnarztpraxisprospekt, pardon Rockalbum des Frühlings. Strahlend schön, wie die Beißerchen der beiden Oberärzt(inn)en auf dem Frontcover.
Anschließend stellt sich die Frage: Was für eine wunderbare Pianomelodie schlängelt sich denn da aus den Boxen? Schmiegt sich an deinen Körper, wie die Silhouette eines längst vergessenen Traumes? Phantom Ghost stoßen mit ihrem Album „Thrown Out Of Drama School“ das Tor in eine romantische Valentinstagsszenerie auf. Die Musik ergießt sich über das Gemüt des Hörers, wie Herzluftballons. Kitschig klingen die Klavierstücke dennoch nicht. Eher vernebeln sie einem die Sinne mit ihren raffinierten Songstrukturen. Die Haken, die das Tasteninstrument hier schlägt -in einem Song, wie dem zauberhaften „The Process (After Brion Gysin)“- sie wirken, als würde man einen Improvisationskünstler in ein balladeskes Korsett stecken. So, als hätten sich The Mars Volta ans Klavier gesetzt und einem Song von Razorlight verstümmelt. Nur merkt man das nicht. Die karg instrumentierten Songs klingen so dermaßen warm und herzlich, dass man in einen Schwebezustand gleitet. Dirk von Lotzows Stimme umarmt einen mit ihren leicht dissonanten Harmonien. Kontrastiert aber nicht etwa den instrumentalen Wahnsinn, der sich da unter dem Gesang breit macht. Seine Stimme bildet vielmehr die perfekte Ergänzung zum verwirrenden Rahmen, den das Drehbuch der Musik vorschreibt. All das kulminiert in einem Cover von „You´re My Mate“. Dem vielleicht schlimmsten Vergehen der näheren Popgeschichte. Und verhallt im Raum. So als wollte die Musik sagen: all ihr Sternchen am Pophimmel, haltet doch einfach mal die Fresse.
Falls derweil jemand noch nicht wissen sollte, was für tanzbare Klänge sich hinter High Contrast verbergen, dem sei gesagt: wenn Drum´n´Bass ein Footballfeld wäre, dann wären High Contrast der Touchdown zum Sieg. Wobei die High Contrast-Variante von Drum´n´Bass meist den Bezug zum Pop nicht vermissen lässt. Soll heißen. Das Ganze klingt manchmal auch nach Junior Senior, Basement Jaxx, Pendulum und Konsorten. Tanzbar, schmissig, herzallerliebst. Und dürfte jedem, der schon mal in den frühen Morgenstunden zu der Punchline „3 o´clock in the morning – on and on and on and on“ die Morgenröte herbei sehnte, wie Vampirjäger, ordentlich Abgehpotenzial bieten. Plötzlich wird alles von einem hellen Schimmern erleuchtet. Die Welt beginnt zu tanzen. Die Grashalme wippen im Takt. Die brennende Sonne zerfetzt die Wolkenformationen am Firmament. Dazu wird fröhlich auf Seite eins zu den größten Versuchungen der künstlerischen Laufbahn von HC das Tanzbein geschwungen. Und dann auf der Bonus Cd auch noch ein wahrer Remix-Hit-Reigen von The Streets bis Adele raus gehauen. „Confidential“ ist eine wahrlich famose Werkshow. Und für mich jetzt schon das Elektro-Paket des Frühlings.
Hinterher besinnen wir uns mal auf einen, der wirklich wichtig war, der seine Fäden aber vorwiegend im Hintergrund zu spinnen gedachte. Die Rede ist natürlich vom famosen Beatbastler J Dilla. Der Produzent, der sich für zahlreiche exquisite Sounds und Beats der HipHop-Geschichte verantwortlich zeigt und der leider inzwischen nicht mehr unter uns weilt. Ihm wird jetzt ein lange überfälliges Denkmal gesetzt. Eine „Dillanthology“. Bzw., der erste Teil davon, denn es scheint unmöglich, alle seine musikalischen Trips auf einem Silberling zu verewigen. Auf der ersten Scheibe finden sich nun also zahlreiche, zurückgelehnte Klassiker von The Pharcyde bis Common, von De La Soul bis Busta Rhymes. Von Erykah Badu bis zu den Roots. 11 Tracks sind es am Ende geworden. Nicht viel, könnte man denken, aber wer ihnen seine Aufmerksamkeit schenkt, der bekommt einen imposanten Einblick in das breite Schaffen des vielleicht talentiertesten und subtilsten Beatbastlers der HipHop-Geschichte. Ein Spektakel, dieser Kerl.
Ähnlich spektakulär, aber in völlig anderer Hinsicht, gerät das neue Album von Kenny Anderson alias King Creosote. Auf „Flick The Vs.“ wird zwar auch subtil mit den Nägeln geklackert, aber die Musik ist in eher indielastigen Gefilden zu Hause. Dazu eine Portion pompösen Pop und fertig ist das Frühlingsalbum. Die Schmetterlinge fangen bei beschwingten Songs wie „No Way She Exists“ plötzlich wie wild mit den Flügeln zu schlagen an. Und wenn man bedenkt, dass der Musiker vorher schon 40 Alben auf dem Buckel hatte – die meisten davon auf CD-R – dann beeindruckt es nur umso mehr, dass hier so gar nichts nach Routine klingt. Zielsicher bewegen sich seine Songs auf dem schmalen Grad zwischen kuscheliger Elektronika und tanzbarem Pop. Jeder Track wirkt irgendwie zeitlos, magisch, seltsam, abwegig, hin und wieder bezaubernd, aber Ermüdungserscheinungen sind keine zu spüren. Stattdessen erschließt sich dem Hörer ein abwechslungsreiches Sammelsurium an Songs, die trotz aller Eingängigkeit eine außerordentliche Faszination ausstrahlen. Wer mal wieder eine wirklich spannende Songschreiberscheibe hören möchte, der kommt um dieses Album nicht herum.
Wer sich derweil die volle Breitseite an klassischem Radiorock mit Wohlfühlfaktor reinziehen möchte, der sollte zum neuen Gesamtpaket aus dem Hause „Radio Rock Revolution“ greifen. 36 Tracks von Cat Stevens bis David Bowie, von den Beach Boys bis zu den Turtles. Von Duffy bis Jimi Hendrix. Von den Kinks zu den Kinks und The Who zu The Who (ja, die gibt’s zweimal). Sie alle schicken sich an, freudetrunken mit dir im Kreis zu hüpfen und den Geist des Rock´n´Roll neu zu beleben. Der gleichnamige Film ist mit Ausnahme des fragwürdigen Endes ja bereits der perfekte Celluloid-Trailer für den anstehenden Partysommer. Nach einigen Durchläufen fragt man sich beim Genuss des Soundtracks allerdings, wie man so lange ohne strahlende Hits der Marke „All Day And All Of The Night“, „Elenore“, „Crimson And Clover“, „Hang On Sloopy“ und „The Wind Cries Mary“ auskommen konnte. Deshalb: Regler hoch und Party machen. Und wenn die Nachbarn an die Wand klopfen, einfach ignorieren. Welcher gute Mensch würde einen schon zwingen, diesen schicken Soundtrack hier abzuschalten… das kann doch nur ein *##’**!$$! sein.
Anschließend ziehen wir uns mal in die hymnisch vertrackte Welt von The Paper Chase zurück. Verdammt, wie sich im Opener ein obsessives Geigen-Gemetzel aus den anmutenden Zeilen schält. Da werden Apocalyptica ziemlich blöd aus der Wäsche schauen. Mit denen haben The Paper Chase aber eh nix am Hut. Dann schon eher mit den Orchester-Verfechtern von Trail Of Dead oder den Größenwahnsinnigen von Coheed & Cambria. Nur dass sie auf „Someday This Could All Be Yours (Part 1)“ all diese Bands einfach links liegen lassen. Stattdessen wird Schönheit mit Dissonanz ad absurdum geführt. Und einfach mal das komplette Postrockfeld umgegraben, als würden sie es genießen sich im Dreck zu suhlen. Ich muss zugeben: ich bin wie erschlagen von dieser Musik. Ich habe seit Ewigkeiten nichts Vergleichbares mehr gehört. Wer die Band mal live erleben durfte, der wird schon beim Gedanken an neuen Stoff aus dem Hause Paper Chase lechzend zum Plattenladen krabbeln. Man kann sich diesen Songs nicht entziehen. Sie prasseln auf einen ein, wie Geldmünzen in Dagoberts Tresor. Und sie kontern die rockende Geste mit stillen Passagen und schicken Comedy-Elementen. Diese Scheibe ist ein Manifest der Möglichkeiten des Postrock. Die anderen sollten sich umschauen, wie sie da hinterher kommen.
Als Vorreiter gelten derweil auch die Schockschwerenöter von Black Sabbath. Deren Meisterstück „Paranoid“ wird jetzt neu aufgelegt und in einer schicken Deluxe Edition auf den Markt geworfen. Die Mucke knallt derweil noch immer rein, wie Elfmetertore. Überhaupt hat das Album nichts von seinem Glanz verloren. Fast vierzig Jahre ist es her, seit dieser Riff-Reigen zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. Und inzwischen wurde „Paranoid“ mit Sicherheit ebenso oft gecovert, wie zitiert. Dennoch ist man dieser Band sofort wieder verfallen, wenn sich die ersten Takte des Songs in die Gehörgänge zwängen, wie Ohrenhöhler. Auf dem dreiteiligen Update des Klassikers bekommt der geneigte Fan alles, was er sich schon immer gewünscht hat. Ein schick aufbereitetes Booklet. Eine glänzende Verpackung und auch in Sachen Musik wurde reichlich aufgestockt. Auf Disc zwei befindet sich das 74er „Quadrophonic Mix“, das bisher nur Sammlern vorbehalten war. Spannender allerdings geraten die Instrumental- und Alternativversionen auf Scheibe 3. Die dienen als perfektes Stimmbandtraining für die nachwachsende Generation an Luftgitarrenverfechtern. Alles in allem kann ich diese Rundum-Glücklich-Paket nur allen Fans blind ans Herzen legen. Und verliere mich jetzt im famosen Schlagzeugsolo von „Rat Salad“, das in zweieinhalb Minuten die Welt der Rockmusik aus den Angeln hebt. Auch 40 Jahre später: einfach umwerfend dieser Sound von Ozzy und Konsorten. Und damit Schluss mit Kopfschütteln. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
 The Airborne Toxic Event
The Airborne Toxic Event Was sich die wunderbare Band
Was sich die wunderbare Band  Anschließend stellt sich die Frage: Was für eine wunderbare Pianomelodie schlängelt sich denn da aus den Boxen? Schmiegt sich an deinen Körper, wie die Silhouette eines längst vergessenen Traumes?
Anschließend stellt sich die Frage: Was für eine wunderbare Pianomelodie schlängelt sich denn da aus den Boxen? Schmiegt sich an deinen Körper, wie die Silhouette eines längst vergessenen Traumes?  Falls derweil jemand noch nicht wissen sollte, was für tanzbare Klänge sich hinter
Falls derweil jemand noch nicht wissen sollte, was für tanzbare Klänge sich hinter 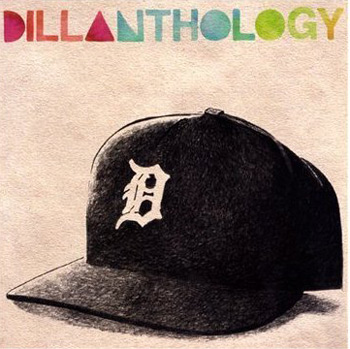 Hinterher besinnen wir uns mal auf einen, der wirklich wichtig war, der seine Fäden aber vorwiegend im Hintergrund zu spinnen gedachte. Die Rede ist natürlich vom famosen Beatbastler
Hinterher besinnen wir uns mal auf einen, der wirklich wichtig war, der seine Fäden aber vorwiegend im Hintergrund zu spinnen gedachte. Die Rede ist natürlich vom famosen Beatbastler  Ähnlich spektakulär, aber in völlig anderer Hinsicht, gerät das neue Album von Kenny Anderson alias
Ähnlich spektakulär, aber in völlig anderer Hinsicht, gerät das neue Album von Kenny Anderson alias  Wer sich derweil die volle Breitseite an klassischem Radiorock mit Wohlfühlfaktor reinziehen möchte, der sollte zum neuen Gesamtpaket aus dem Hause „
Wer sich derweil die volle Breitseite an klassischem Radiorock mit Wohlfühlfaktor reinziehen möchte, der sollte zum neuen Gesamtpaket aus dem Hause „ Anschließend ziehen wir uns mal in die hymnisch vertrackte Welt von
Anschließend ziehen wir uns mal in die hymnisch vertrackte Welt von 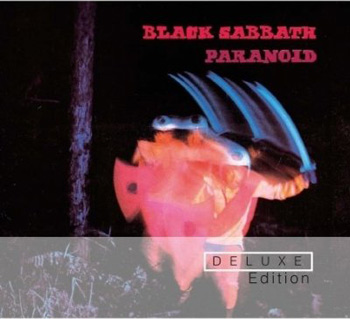 Als Vorreiter gelten derweil auch die Schockschwerenöter von
Als Vorreiter gelten derweil auch die Schockschwerenöter von
UND WAS NUN?