Was für ein Teufelskerl, dieser Hell. Jetzt nennt er sein neues Album auch noch „Teufelswerk“ und schaut auf dem Cover ganz schön finster drein. Die Flammen lodern noch in seinem Herzen. Das merkt man auf den beiden Scheiben, die passender Weise in „Night“ und „Day“ untergliedert wurden. Alle, die dachten, der Schöpfer der „Munich Machine“ würde sich so langsam auf den Ruhestand vorbereiten, müssen eingestehen: 11 Jahre nach dem großen Wurf ist „Teufelswerk“ mehr Meister-, als Alterswerk. Das liegt einerseits an den nächtlichen Eskapaden, die er auf der ersten Scheibe vertont. Mit freundlicher Unterstützung von Bryan Ferry und (obacht!) P.Diddy, der das famose „The DJ“ mit seinen Punchlines befeuert, macht sich Hell auf, die Vorherrschaft in Sachen technoider Discosounds wieder an sich zu reißen. Nachdem seine letzten Platten stellenweiße in der Masse der Veröffentlichungen untergingen, kämpft sich Hell mit acht pulsierenden Tracks zurück an die Spitze der Technoszene. Endlich ein Album, das den direkten Vergleich mit seinen famosen Liveauftritten nicht zu scheuen braucht. Ein ausgeklügeltes Manifest zwischen den Polen Chicago House und Detroit Techno. Scheibe zwei dann, die Sonnenseite, ist sein Beitrag zum 70er Jahre-Retrotrend. Hier nimmt Hell Bezug auf die Musikgeschichte in hiesigen Gefilden. Mit den immer wieder aufschimmernden Krautrock-Anleihen huldigt er dem Sound von Kraftwerk oder Can. Auch Pink Floyd, Tangerine Dream und Amon Düül lassen grüßen. Die Songs strahlen eine relaxte, nahezu improvisierte Atmosphäre aus. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal ein solch mutiges Album von einem elektronischen Künstler gehört habe. Lediglich Carl Craig & Moritz von Oswald operierten mit ihrer „Recomposed“-Platte in einer ähnlichen Liga, wenn auch in einem völlig anderem Kreissaal. Alles in allem fällt mir am Ende eigentlich nur noch eins ein: „Teufelswerk“ ist neben „Munich Machine“ Hells unbestrittenes Meisterwerk. Die Platte reißt Grenzen ein. Sie traut sich was. Und wer „zum Teufel“ hätte damit noch gerechnet?
Anschließend kramen wir dann mal in die Plattenkiste mit Anthony Rother. Der Begründer der Plattenlabel psi49net, Stahl Industries, Datapunk und Telekraft Recordings präsentiert auf dem neunten Teil der Sampler-Reihe „Fuse Presents…“ einen treibenden Mix schmissiger Groove-Elektronika, die sich galant auf die Tanzfläche schlängeln. Der gebürtige Frankfurter versammelt neben Boys Noize, John Starlight und Baustein noch zahlreiche weitere Vertreter der elektronischen Zunft, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich soundtechnisch zu verrennen. Stattdessen hat man zunehmend das Gefühl, dass sich hier jemand ganz bewusst auf seine Stärken besinnt. Auch wenn der Scheibe so mancher Abstecher in abseitige Gefilde sicher gut getan hätte, ist „Fuse presents…“ ein gefundenes Fressen für Freunde puristischer Elektronik-Welten. Ein eingängiger Mix ohne große Überraschungen, der sowohl im Club, als auch im heimischen Wohnzimmer, seine Wirkung entfalten sollte.
Lindstrom & Prins Thomas wagen sich derweil in psychedelische Gefilde und entwerfen eine minimalistische Weltraum-Oper für hoffnungslose Melancholiker. Die sechs- bis dreizehnminütigen Eskapaden ihres Album „II“ wirken wie ein musikalischer Ritt durch die Milchstraße. Schwerelos verhallt die Musik im Raum und schlängelt sich um den Körper des kuschelbedürftigen Hörers. Manchmal spürt man sogar den Einfluss des alten Kumpels „Krautrock“, wenn sich die eine oder andere experimentelle Passage in die Stücke schleicht. Jedenfalls lässt man sich nur zu gerne von dieser Musik in eine andere, uferlose Welt stoßen, in der jegliche Konturen verschwimmen, wie gestrandete Walfische.
Womit wir dann bei Krazy Baldhead angelangt wären. So heißt sie: die neue Wunderwaffe aus dem Hause Ed Banger. Der Elektroballermann allerdings steht weiter auf Warteschleife. Alleskäufer des Labels sollten deshalb auch lieber einen Probelauf absolvieren. Die Einflüsse des Franzosen reichen nämlich von den Chemical Brothers bis hin zu Miles Davis. Womit auch schon die Frage beantwortet sein dürfte, warum sich sein Album in vier epische Kapitel aufspaltet, die wiederum in einzelne Passagen gegliedert sind. Seine Musik ist schlicht und ergreifend ein monströser Grenzgänger zwischen den Polen Elektro und Jazz. Und wirkt dadurch fast wie ein Fremdkörper im Hofstall der elektronischen Glückseligkeit. Stattdessen klingen manche Passagen fast schon subtil, wenn man sie mit dem üblichen Gewalze vergleicht, das die werten Ed Banger-Kollegen da abfeuern. Live allerdings dürfte das in Sachen Intensität kein großes Hindernis sein. Der ausgebildete Jazzer präsentiert sich nämlich gerne mit Band, anstatt die Tasten des Mischpults zu bedienen. Daraus entspringen imposante Jam-Sessions, bei denen kein T-Shirt trocken bleibt. Alles in allem schön zu sehen, dass Ed Banger sich anno 2009 breiter aufstellt. „The B-Suite“ gehört jedenfalls zum imposantesten, was das Label seit dem großen Wurf von Justice in die elektronische Umlaufbahn geschleudert hat. Demnächst liegt es dann an Uffie, mit einem brachialen Effektgewitter nachzulegen. Wir sind gespannt…
… und gebens uns jetzt mal eine Spur poppiger. Wer etwas für luftige Elektro-Hüpfer der Marke Prince übrig hat, dessen Größenwahn aber gerne mal ausklammert, der sollte sich das neue Album von den Junior Boys reinziehen. Die widmen sich auf „Begone Dull Care“ zeitgenössischem „Elektro-Pop“ und klingen dabei wie eine Breitwandversion von Phoenix mit Engelsflügeln. Soll heißen: die Band hüllt einen watteweich ein. Nichts muss, alles kann. Die Devise ihres neuen Albums scheint zu lauten, bloß nicht allzu sehr auf die Euphorie-Taste drücken. Stattdessen schlängeln sich „Dull To Pause“ oder das famose „Hazel“ eher beiläufig in die Gehirnrinde. Pop wird hier eher im Sinne der Pet Shop Boys verstanden. Soll heißen: Aufdringliche Gassenhauer für die Partyfraktion sucht man vergebens. Die Junior Boys sind gekommen um zu bleiben und so nimmt man sich auch gerne mal etwas Zeit, um die Message an den Hörer zu bringen. Letztlich verwundert es dabei nicht, dass viele der Songs Schritt für Schritt auf den großen Moment zusteuern, ihn aber dann konsequent abwürgen. Gerade in diesem vordergründigen Scheitern liegt nämlich der Schlüssel zur Langlebigkeit dieser Scheibe. „Begone Dull Care“ ist ein grandioses Werk, dessen wahre Größe sich dem Hörer allerdings erst auf den zweiten Blick eröffnet.
Warren Fischer and Casey Spooner alias Fischerspooner gehören währenddessen ja schon seit Jahren zu den wegweisenden Gestalten im Elektro-Pop. Mit ihrem neuen Album „Entertainment“ verteidigen sie ihre Ausnahmestellung in der gegenwärtigen Discolandschaft. Die Songs klingen auch anno 09 so euphorisch, dass das Ganze nicht zum bloßen Elektro-Ballermann verkommt. Man kann sich nie so richtig sicher sein, ob das jetzt gekonnt abgebauscht oder innovativ ist. Geschichte und Zeitgeist werden hier aufs Treffendste zusammengeführt und sorgen für einen kurzweiligen Elektromoment der Sonderklasse. Nach dem gefloppten Vorgänger dürften sie sich für „Entertainment“ wieder den Preis als innovativstes Unternehmen im Zeitgeist-Planschbecken überstülpen. Ein Track wie „Money Can´t Dance“ wirkt schlicht erhaben. Und wenn dann hinterher alles „In A Modern World“ überführt wird, ist man einfach nur hingerissen von solch balladesker Elektro-Raffinesse. Ein Album zum Tanzen, Träumen, Lieb gewinnen. „Entertainment“ vertont den erhabenen Moment sich umarmender Schatten im Antlitz der Morgensonne.
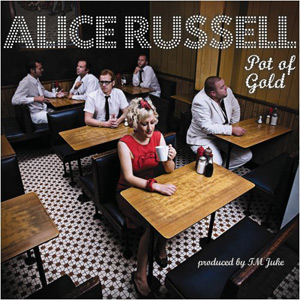 Ähnlich tanzbar gerät auch der neue Output aus dem Hause Alice Russel. Die Soulqueen klatscht mit ihrem vierten Album „Pot Of Gold“ mal wieder alle an die Wand, die da in schicken Outfits einen auf Alicia Keys machen. Wer sie bereits von famosen Gastauftritten bei Fat Freddy´s Drop kennt, dürfte hingerissen sein von diesem elfteiligen Soulentwurf, der sich geradewegs ins Blitzlicht der „Poparazzi“ stürzt. Mit ihren zeitgemäßen Sounds, die das Spektrum zwischen Funk, Soul, Gospel, Jazz und HipHop ausloten, sollte ihr nun auch hierzulande der große Erfolg vergönnt sein. Selbst Daddy G von Massive Attack ist schon voll des Lobes für die Amerikanerin, die Joss Stone mal eben aussehen lässt, wie einen kargen Felsvorsprung in den Untiefen der Poplandschaft. „Her voice is so good I was thinking of calling her up to do some Massive Attack stuff” hat er neulich zu Protokoll gegeben. Und er wäre ja auch blöd, wenn nicht. Dieses Album glitzert. Die Produktion sitzt. Und am Ende ist man dermaßen berauscht, dass man ganz traurig zur Anlage blickt, wenn die letzten Töne der Musik verklingen.
Ähnlich tanzbar gerät auch der neue Output aus dem Hause Alice Russel. Die Soulqueen klatscht mit ihrem vierten Album „Pot Of Gold“ mal wieder alle an die Wand, die da in schicken Outfits einen auf Alicia Keys machen. Wer sie bereits von famosen Gastauftritten bei Fat Freddy´s Drop kennt, dürfte hingerissen sein von diesem elfteiligen Soulentwurf, der sich geradewegs ins Blitzlicht der „Poparazzi“ stürzt. Mit ihren zeitgemäßen Sounds, die das Spektrum zwischen Funk, Soul, Gospel, Jazz und HipHop ausloten, sollte ihr nun auch hierzulande der große Erfolg vergönnt sein. Selbst Daddy G von Massive Attack ist schon voll des Lobes für die Amerikanerin, die Joss Stone mal eben aussehen lässt, wie einen kargen Felsvorsprung in den Untiefen der Poplandschaft. „Her voice is so good I was thinking of calling her up to do some Massive Attack stuff” hat er neulich zu Protokoll gegeben. Und er wäre ja auch blöd, wenn nicht. Dieses Album glitzert. Die Produktion sitzt. Und am Ende ist man dermaßen berauscht, dass man ganz traurig zur Anlage blickt, wenn die letzten Töne der Musik verklingen.
Einen äußerst vielseitigen Klangsalat servieren uns hinterher General Elektriks. Mal wird geschmachtet, dann wieder gefeiert bis der Schweiß von der Decke tropft. „Good City For Dreamers“ mischt einfach alles zusammen, was nicht niet und nagelfest ist. Funkanleihen, HipHop-Beats, Cineastisches, Orchestrales, Poppiges. Nichts ist sicher vor Hervé „RV“ Salters. Der gebürtige Franzose scheint einfach alles zu infiltrieren, was ihm unter die Finger kommt und fabriziert in seinem Experimentierkasten allerhand schicke Melodien, die einen einlullen, wie die Musik von Air. Man fühlt sich, als würde man in eine Geisterbahn geschubst und von allen Seiten mit verqueren Silhouetten konfrontiert. Silhouetten von Songs, die einen durchdringen. Die einen umgarnen, wie ein poppiger Schleier und einen sanft aufs Sofa schubsen. Wer dachte in Sachen Chillout wäre schon alles gesagt, der darf sich von dieser Musik eines Besseren belehren lassen. Die zudem eingestreuten Uptempo-Passagen sorgen dafür, dass man nicht den Anschluss verliert. Nicht einnickt vor lauter Wohlfühlpop. Sondern auch mal begeistert aufspringt und die Hüften schwingt.
Zum Abschluss gibt’s noch eine Prise form vollendeter Popmusik. Dear Euphoria alias Elina Johansson setzt sich ans Piano und singt in solch himmelhoch jauchzender Erhabenheit, dass man sich in ein mehrstöckiges Operngebäude versetzt sieht. Die glasklare Stimme der Protagonistin nimmt einen mit auf eine Reise in die Welt von Glockenspiel und Kuschelatmosphäre. Das Schönste daran ist, dass man es bei „Heal My Violence“ nicht mit einem nervtötendem Sirenisierungs-Irrsinn zu tun hat. Die Platte blickt verstohlen zur Seite – so als hätte sie Angst, dem Hörer mit ihren Songs auf die Nerven zu gehen. Diese Angst allerdings ist völlig unbegründet. Von diesen zärtlich gehauchten Songs lässt man sich nur zu gerne auf eine erholsame Reise mitnehmen. Alles in allem ein imposantes Werk zwischen The Knife und Operette. Anziehende, schmachtende Musik. „Heal My Violence“ ist schlicht und ergreifend Pop in seiner reinsten Form. Und damit genug geschmachtet. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// von alexander nickel-hopfengart
 Was für ein Teufelskerl, dieser
Was für ein Teufelskerl, dieser  Anschließend kramen wir dann mal in die Plattenkiste mit
Anschließend kramen wir dann mal in die Plattenkiste mit 
 Womit wir dann bei
Womit wir dann bei  … und gebens uns jetzt mal eine Spur poppiger. Wer etwas für luftige Elektro-Hüpfer der Marke Prince übrig hat, dessen Größenwahn aber gerne mal ausklammert, der sollte sich das neue Album von den
… und gebens uns jetzt mal eine Spur poppiger. Wer etwas für luftige Elektro-Hüpfer der Marke Prince übrig hat, dessen Größenwahn aber gerne mal ausklammert, der sollte sich das neue Album von den  Warren Fischer and Casey Spooner alias
Warren Fischer and Casey Spooner alias 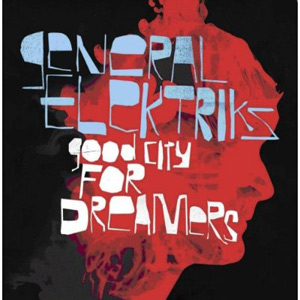 Einen äußerst vielseitigen Klangsalat servieren uns hinterher
Einen äußerst vielseitigen Klangsalat servieren uns hinterher  Zum Abschluss gibt’s noch eine Prise form vollendeter Popmusik.
Zum Abschluss gibt’s noch eine Prise form vollendeter Popmusik.
UND WAS NUN?