Die Silversun Pickups haben sich ja bereits mit ihrem Debütalbum „Carnavas“ über den Status des Geheimtipps erhoben. Nun möchten sie mit „Swoon“ die Weltherrschaft an sich reißen. Zeitgemäß aufpoliert für die Indie-Kids von heute wurde alles eine Spur poppiger produziert und so eine Hitsammlung geschaffen, die allen, die den 90ern mit offenen Armen gegenüber stehen, die Freudentränen über die Wangenknochen treiben werden. „Swoon“ ist ein vergrungtes Indie-Album der klassischen Sorte mit einem gewissen Hang zum breitenwirksamen Getöse. Das jetzt aber bitte nicht falsch verstehen. Diese neue Offenheit ist nämlich nicht etwa ein Ärgernis. Nein, bei der Band um Sänger Brian Aubert steht nach wie vor die Musik im Vordergrund. Die Produktion kann hier noch so erhaben klingen, das wichtigste -der Song- verreckt nicht in den endlosen Weiten der Aufnahmemöglichkeiten. Das zeigt sich unter anderem bei dem großartigen, stellenweise ausufernden „Growing Old Is Getting Old“. Gerade, als man Angst bekommt, die Band könnte endgültig abschweifen und verträumt ins Kiesbett schlittern, schält sich nach einem sanften Bruch eine ächzende Gitarre zwischen die Musik und lässt den Track auf ein famoses Finale zusteuern. Die Silversun Pickups bahnen sich mit diesem Album geradewegs ihren Weg in die Herzen der Pophörer. Tief im Inneren aber bleiben sie eine Rockband. Das beste Beweis dafür liefern sie gleich mit: „Panic Switch“ ist jetzt schon die Sommerhymne des Jahres. Kurz gesagt: Sommersonne, hier kommt der passende Soundtrack zu deinem schönsten Grinsen. Die Baggerseeparty kann beginnen.
Shameboy vertonen auf „At The Pyramid Marquee“ derweil die Glückseligkeit des eingängigen Popmoments. Irgendwo zwischen den Polen Justice und Daft Punk entfachen sie auf ihrem Livealbum ein tanzbares Partyprogramm, das auch im heimischen Cd-Player seine volle Wirkung entfaltet. Immer wieder ist man geneigt am Schreibtisch in hektischen Fingerklopf-Pogo zu verfallen. Irgendwann trommelt man dann auf alles ein, was einem unter die Finger kommt. Wirft Gegenstände durch den Raum. Bemalt die Wände mit Wasserfarben. Kurz gesagt: da geht einiges. Also doch mal nachgeschaut? Wer oder was ist das denn überhaupt, das hier zum Abgehen einlädt? Im Netz stößt man auf ein ziemlich bemerkenswertes Video. Da tanzt dann eine Roboter-Dame so hektisch über die Straßen der Stadt, dass die Neugier nicht mehr zu zügeln ist. Antworten findet man schließlich in Belgien. Da kommen die beiden Jungs nämlich her. Und sind auch schon seit fünf Jahren fleißig am Rummodeln. Der Rest ist NuRave reinster Gattung. Ein treibendes Vergnügen für alle Tanzhasen. Musik die geradewegs auf den großen Moment zusteuert. Und deshalb auch keiner weiteren Worte bedarf. Einfach das DVD/Cd Gesamtpaket in die Halterungen der heimischen Stereoanlage pfeffern und ab dafür… da geht einiges.
Anschließend fällt mir eigentlich nur noch eins ein: seltsam, dass das so gut funktioniert, was Knut und die herbe Frau da fabrizieren. Es ist ja auch ein schmaler Grad zwischen Pop, Punk und Liebeslied, den die beiden Jungs(!) da einschlagen. Orientalische Melodien eröffnen das gleichnamige Album. Irgendwie scheinen sich hier Jens Friebe und Die Ärzte zu vereinen. „Sing, sing und liebe mich“ – was für ein Refrain. Ich hör sie schon laut schreien auf den Tanzflächen. Scheiß auf deine/n Ex. „Jetzt blühen wir auf, wie diese Welt“. Meinen die das jetzt ernst? Überhaupt dieses Spiel mit den Doppeldeutigkeiten, das beherrscht der Knut mit seiner herben Frau quasi par excellence. Und weil zudem alles so schön hitverliebt nach Tanzfläche schreit, dreht man sich schon nach wenigen Minuten wie ein Wirbelwind im Blitzlicht. In Schutt und Asche liegen hier allerdings nicht nur die Beziehungen zwischen Menschen, sondern auch die Verflechtungen mit dem System. Durchströmt von wunderbaren Pianoklängen erheben sich Knut und die herbe Frau damit weit über die einfältigen Jungs und Mädels aus den Charts, die mit ihrer Befindlichkeitslyrik das Formatradio drangsalieren. Das hier ist Kammermusik für den Indieclub. Die Popfratzen können einpacken.
Die sechsköpfige Crew Lacrosse schlägt hinterher mit ihrem famosen Opener „We Are Kids“ in eine ähnliche Kerbe. Zumindest musikalisch. Da wird ganz lieblich in die Tasten geschmettert, bis plötzlich alle wild durcheinander brüllen. Dass sie dazu noch Gitarren am Start haben und jede Menge gute Laune im Gepäck, kann da schon mal nicht schaden. „Bandages For The Heart“ ist ein Album wie die Long Blondes auf Besuch bei Arcade Fire. Dazu ein bisschen ungestümes Nostalgiegehabe der Marke Blondie und fertig ist der (Indie)Hit. In den UK haben sie damit schon für ein sanftes Plätschern im Schwimmbecken gesorgt. Jetzt wollen die sechs Schweden aber so richtig Welle machen und die Strände der Welt erobern. In dem euphorischen „You Are Blind“ gelingt ihnen das ganz hervorragend. Und mit zunehmender Länge fühlt man sich als Hörer dann auch gut aufgehoben in diesem famosen Mix aus kindlicher Naivität und schmissigen Popmelodien. Die aufblinzelnde Melancholie allerdings, die sich hin und wieder in die Musik schleicht, steht ihnen nicht ganz so gut zu Gesicht. Der gleichnamige Titelsong verleitet zum Gähnen, wird aber hinterher wieder von der ungestümen Energie des Sextetts zurück geschlagen. Alles in allem ein hübscher Zeitvertreib für Fans von Pony Up! und Konsorten.
„Wassn da jetzt los?“ werden sich derweil viele fragen, die das neue Album von Marmaduke Duke in den Player schmeißen. Auf dem zweiten Teil der als Trilogie angelegten Experimentierparty namens „Duke Pandemonium“ legen sich Simon Neil von Biffy Clyro und JP Reid von Sucioperro mal wieder ordentlich ins Zeug, die Hüftmuskeln der Hörer zu strapazieren. Mitten im Spannungsfeld von Disco-Funk und Nu-Pop entern die beiden Rocker die Tanzfläche der ortsansässigen 80er Jahre Diskothek. Das Album beginnt mit einem solch vehementen Klackern, dass man erstmal meint, die Anlage wäre am Arsch. Nachdem man sich allerdings versichert hat, dass dem nicht so ist, haben die beiden sofort die volle Aufmerksamkeit. Auf Mähne-Schütteln und Headbangen muss bei den Dukes allerdings weitestgehend verzichtet werden. Stattdessen wird Elektro Pop mit einer Portion Billy Joel gestreckt und mit einem Tupfer Prince verziert. Schlicht entzückend, was die Jungs da an Melodien raus hauen. „Duke Pandemonium“ ist ein ambitioniertes Post-Pop-Musical mit jeder Menge nostalgischen Zitaten. Da kann man eigentlich gar nicht anders, als sich dem Blitzlicht der Tanzfläche auszuliefern und mit dem Popo zu wackeln. Marmaduke Duke ist Turbonegro im Popstar-Look. Kurz gesagt: der perfekte Wellness-Trip für die Rocker-Clique.
Maria Taylor wendet sich derweil auf ihrem neuen Album immer weiter dem Pop zu. Auf „LadyLuck“ gibt sie sich anschmiegsamer denn je. Zwei Kerzen anzünden solle man sich zu den Songs und dazu ein paar Kopfhörer über das Haupthaar stülpen. Die Horizontale ist das Ziel, aber doch bitte trotzdem nicht abschweifen. Der blutleere Titelsong wird deshalb auch gekontert von einem famosen Tanzflächenkuschler namens „Time Lapse Lifeline“ und plötzlich ist er wieder da: dieser Charme, der die früheren Aufnahmen der Künstlerin auszeichnete. Azure Ray lassen grüßen im anschließenden „It´s Time“ und hin und wieder ist die Musik sogar von solch betörender Größe, wie das letzte Album von Au Revoir Simone. Maria Taylor wandelt mit dieser Musik auf dem schmalen Grad zwischen Radiopop und erhabener Songschreibermelancholie. Das sorgt nicht nur für reichlich Abwechslung, das funktioniert am Ende gerade wegen der kontrastreichen Instrumentierung auch besser als gedacht. Kurz gesagt: Experiment gelungen, Maria Taylor ist sich treu geblieben, hat aber auch die Charts nicht aus dem Blick verloren. Damit steht sie ihrem ehemaligen Freund Conor Oberst in nichts nach – der überführt ja Herzschmerz auch nahezu perfekt auf die große Bühne. Mit diesem Album zieht sie nun gleich und verarbeitet nebenbei auch noch die Trennung zu dem talentierten Bright Eyes-Sänger.
Irgendwie schade derweil, dass der Hype um den Zauberkünstler Sway hierzulande nie so richtig ankam. Dabei macht der eigentlich durchaus schmissige Musik – so eine hüpfende Mischung aus Grime und Rap. Auf seinem aktuellen Tune „The Signature LP“ legt er los, als wollt er direkt beim Vorgänger andocken. „Fit 4 A King“ wäre in einer besseren Welt der HipHop-Tune des Frühlings. Abseits dieses ganzen Gebelles um dicke Hose und fette Klunker vermummt er sich hinter seiner britischen Flagge und zeigt allen, wie man sich in großen Lettern auf die Bildfläche des Pop projiziert. Natürlich muss man sich bei so manchem Track eingestehen: Jay-Z hat hier genauso seine Spuren hinterlassen, wie Wiley. Aber das Gesamtbild ist schlüssig. Und die illustre Riege an Gaststars von Akon bis Lemar dürfte vielleicht sogar dafür sorgen, dass er endlich den Respekt bekommt, den er schon lange verdient. Sway hatte ja schon immer diese Neigung, den einen oder anderen Track mit einer poppigen Melodie zu verzieren, wie Rahmenhandlungen. Aber in diesem Film steht immer noch die Story an erster Stelle. Umso schöner, dass er sich auf den 16 Tracks einiges einfallen lässt, was zum Nachdenken anregt. Damit kann er nämlich auch darüber hinwegtäuschen, dass mancher Track vielleicht etwas zu R´n´B-lastig geraten ist. Dennoch: ein echter Zauberkünstler, dieser Sway. Was er gleich hinterher mit den beiden Brasilianern Amon Tobin und Joe Chapman noch mal unter Beweis stellt. Als „Two Fingers“ vertonen die beiden Elektroniker einen wahnwitzigen Percussion-Trip durch zeitgenössische Rapgefilde. Da haben Timbaland und Missy Elliott sichtlich ihre Spuren hinterlassen. Jedenfalls bimmelt hier alles so zeitgemäß, wie Kirchturmglocken. Und wenn zwischenzeitlich auch noch Ms. Jade und Cecile ans Mikrofon greifen, um Dauergast Sway eine kleine Atempause zu gönnen, ist noch dazu für die nötige Abwechslung gesorgt. So entpuppt sich Two Fingers Feat. Sway am Ende als das brillantere Tune. Zumindest aus meiner subjektiven Sicht. Ich mag eben HipHop, der keine großen Gefangenen macht. Sich aufs Wesentliche beschränkt und poppigen Melodien den Mittelfinger zeigt. Weil hier also größtenteils der Soulgesang gegen die energische Breitseite eines Beatgewitters eingetauscht wurde, kann ich hier wesentlich befreiter im Kreis hüpfen. Kurz gesagt: Die Partyfraktion sollte zu Two Fingers greifen. Der Rest schnappt sich die „Signature LP“. Oder am besten einfach alle beide. Lohnt sich auf jedem Fall.
„Smoke The Monster Out“ nennt sich derweil das Debütalbum des „kalifornischen Briten“ Damian Lazarus. Der produziert auf seinem ersten Album House und Techno im Breitwandformat. Versucht dabei allerdings auch dem klassischen Songformat gerecht zu werden. Sogar an Coverversionen von Neil Diamond („Taxi Taxi“) und Scott Walker („It´s Raining Today“) hat er sich herangewagt. Dazu werden auch mal Pianomelodien verwoben, wie im Kinderlied „Moment“, das gegen Ende gar an verstörende Momente der Marke The Knife erinnert. So sprengt seine Musik zunehmend das elektronische Korsett und treibt hinüber in Liedermachergefilde. Einflüsse werden spürbar von Jeff Buckley bis Nick Cave. Man spürt, dass da jemand ganz bewusst Grenzen auslotet. Alles ist erlaubt, was im „House“ Damian Lazarus seinen Platz findet. Fast so als hätte er sich mit dem Album einen ganz persönlichen Lebenstraum erfüllt – ein Mixtape zu Ehren der Musik, die ihn als Künstler beeinflusste. In dieser subtilen Form dargereicht, kann man dieses Experiment, trotz kleinerer Hänger, am Ende nur als gelungen bezeichnen. Und damit genug geschwärmt für heute. Wir lesen uns beim nächsten Zuckerbeat.
// von alexander nickel-hopfengart
 Die
Die 
 Anschließend fällt mir eigentlich nur noch eins ein: seltsam, dass das so gut funktioniert, was
Anschließend fällt mir eigentlich nur noch eins ein: seltsam, dass das so gut funktioniert, was 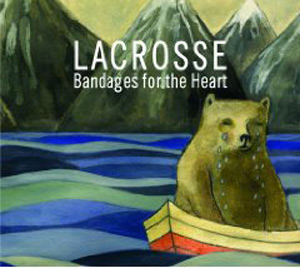 Die sechsköpfige Crew
Die sechsköpfige Crew  „Wassn da jetzt los?“ werden sich derweil viele fragen, die das neue Album von
„Wassn da jetzt los?“ werden sich derweil viele fragen, die das neue Album von 
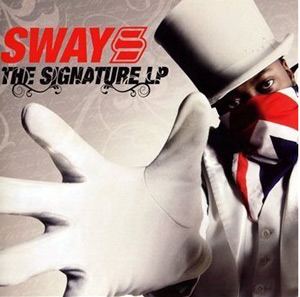 Irgendwie schade derweil, dass der Hype um den Zauberkünstler
Irgendwie schade derweil, dass der Hype um den Zauberkünstler  „Smoke The Monster Out“ nennt sich derweil das Debütalbum des „kalifornischen Briten“
„Smoke The Monster Out“ nennt sich derweil das Debütalbum des „kalifornischen Briten“
UND WAS NUN?