Jetzt geht das schon wieder los. Alle von Pitchfork bis zum Observer sind sich einig: Grizzly Bear werden der nächste große Wurf im Popgeschäft sein. Die neue Platte „Veckatimest“ mutet an, wie ein Mix aus Belle & Sebastian und Animal Collective. Schönklang und vertrackte Melodien bekriegen sich und werden mit einem Folkkorsett ausgestattet. Nach der imposanten Remix EP „Friend“ besinnt sich die Band nun wieder auf ihre eigenen Vorstellungen und liefert ein Album voll spannungsgeladener Popmusik ab. Am Schönsten gerät das von den Beach Boys beeinflusste „Two Weeks“, das so entspannt vor sich hinsurft, dass man meint, es würde sich ein Sandstrand im Wohnzimmer ausbreiten.Das warme Wasser schmiegt sich sanft an die nackten Füße und die Sonne verfärbt dir den Oberkörper. Bemerkenswert ist allerdings, wie es die Jungs schaffen, hinter all dem ambitionierten Getue immer wieder eine Popmelodie einzuflechten. Erst bemerkt man das gar nicht, aber dann sticht es einem fast zwangsläufig ins Gesicht, was sich da so alles hinter der „Wall Of Soundexperiment“ versteckt. Nach mehreren Durchläufen schälen sich die Songs auf, wie überreife Kastanien. Die Melodien glitzern hell, wie Edelsteine. Und am Ende kann man dann gar nicht anders, als den ganzen Lobeshymnen aus dem Rezensionswald eine weitere hinzuzufügen. Grizzly Bear wickeln einen ein und man kann sich beim besten Willen nicht dagegen wehren.
Ähnliches gilt für John Vanderslice. Nach dem etwas überambitionierten Vorgänger erwartet man von ihm allerdings erstmal Wiedergutmachung. „Romanian Names“ gibt sich dann auch im Vergleich zu „Emerald City“ weniger Effekt-überladen. Vanderslice scheint mit diesem Album immer mehr zu sich selbst zu finden. Seinen grandiosen Liveshows hechelt die Scheibe zwar immer noch hinterher, wie eine lechzender Köter, aber ansonsten fühlt man sich schön-schaurig in den Arm genommen, wenn sich im zweiten Song (Titel lagen mir in diesem Fall leider noch nicht vor) eine sanfte Rückkopplung aus dem entspannten Soundgewand schält. Der Schreck weicht schließlich einem wohligen Schauer, der die Welt um einen herum verschwimmen lässt. Man taucht ein in die Welt von Vanderslices Musik und lässt sich von einem beschwingten Hüpfer, wie Song Nummer drei, auf Flügeln gen Vollmond geleiten.
Patrick Watson & The Wooden Arms legen hinterher erstmal eine große weiße Fläche vor dem Hörer aus. Ist das noch Stille oder schon wieder Ambient, fragt man sich unaufhörlich nach den ersten Wogen vom Opener „Fireweed“, die da sanft auf einen zuschwappen. Nun ja. Lärm macht er nicht viel, der liebe Patrick. Aber „Wooden Arms“ ist trotzdem ein echter Ohrenschmaus. Das fragile Artwork trägt der Musik Rechnung. Es lotet die dunkle Seite der Seele aus und versucht sie auf ein treffendes Motiv zu übersetzen. Das gelingt auch der Musik… getragen von Streichern und Piano entfährt des Sängers Mund ein sanftmütiges Schluchzen. Die schaurige Stimmung und die eingestreuten Brüche fügen sich schlüssig zusammen auf 11 Songs, die man sich am besten bei Kerzenschein und guten Wein genehmigen sollte. Ein stilles, fast mucksmäuschenstilles Album, das seine Kraft aus den vertrackten Kompositionen zieht, die hier wirken, wie dunkle Schatten aus den Zwischenräumen unseres Daseins.
Masha Qrella ist im direkten Vergleich dazu beinahe eine Frohnatur. Im Opener überführt sie ihr melancholisches Organ gleich mal in einen fast sommerlichen Gitarrensound der Marke Whitest Boy Alive. „Speak Low (Loewe & Weill In Exile)“ klingt überraschend aufgeräumt. Eben so, als hätte eine Elektronikerin sich an einer Songwriterplatte versucht. Und würde man nicht wissen, dass es sich hier bisweilen um Fremdkompositionen handelt, man würde wohl nicht auf die Idee kommen, dass die Musik nicht von ihr selbst stammt. Sie übersetzt vielmehr, wie im Untertitel der Scheibe bereits vermerkt, Originale von Kurt Weill und Frederick Loewe in einen poppigen Kontext. Hier gibt’s also Broadway-Stücke, die in ihrer ursprünglichen Form mal ziemlich hochtrabend klangen. Nun allerdings reduziert Qrella die Songs auf das Wesentliche. Gräbt sich so zum Kern der Stücke vor und pflanzt daraus ein zauberhaftes Bäumchen, das einem im Sommer ein schattiges Dach über den Kopf wirft. Unterkühlte Musik mit so viel Gefühl habe ich selten gehört. Diese Platte ist ein Widerspruch in sich, der sich vielleicht auf ihren Live-Konzerten auflöst. Die Künstlerin spielt unter anderem im Jugendkulturhaus Cairo in Würzburg. Und zwar am 11.6. Also unbedingt hingehen. Vielleicht lüftet sich da ja auch das Geheimnis um ihre Musik.
Und weil wir gerade so schön beim Schwärmen sind, widmen wir uns doch mal kurz einem kleinen aber feinen Album namens „Does You Inspire You“. Gute Frage eigentlich, die Chairlift da aufwerfen. Also hier mal die Fakten: die Single „Bruises“ ging vor einigen Wochen schon steil, wie Spiderschweine, aber auch das Album strahlt eine betörende Wirkung aus. Ich muss komischer Weise immer wieder an die Mucke von Garbage denken, aber vielleicht liegt das auch daran, dass der Opener den Namen der vergessenen 90er Jahre Indie-Band trägt. Der Song „Planet Health“ und das unsägliche „Earing Town“ gehen derweil gar nicht. Die klingen wie Wellness-Mucke für die Schönheitsfarm. Aber unabhängig davon schafft es die Band über weite Strecken jegliche Klischees zu Umschiffen und sich mit einem Hauch orientalischem Charme einen Platz im Herzen der Indie(Pop)-Fraktion zu erkämpfen. Am Packendsten gerät dabei der französische Abba-Schmatzer namens „Le Flying Saucer Hat“. Dafür regnet es Handküsse. Und auch sonst fühle man sich eigentlich sehr wohl in diesem Kabinett der Absurditäten. „Does You Inspire You“ ist ein durch und durch „besonderes Album“.
So wie das von der einfach nur umwerfenden Georgia Anne Muldrow. Die ist so ein bisschen das weibliche Gegenstück zu Outkast. Oder die durchgeknalltere Lauryn Hill. In jedem Fall strahlen ihre Stücke (oder sagen wir mal Skizzen) eine ambitionierte Haltung aus, wie man sie im aktuellen HipHop- oder Soul-Geschäft nur sehr selten findet. Vom Sound her hätte man sich vielleicht gewünscht, sie hätte mal einen Track mit dem leider verstorbenen Dilla aufgenommen. Auf „Ms. One & The Gang“ versucht sie sich jedenfalls an einer Art Compilation, zu der sich eine illustre Riege an Gaststars der Marke Black Milk, Dudley Perkins und Stacey Epps im Studio eingefunden hat. Im Gegensatz zum schlichtweg brillanten Vorgänger sind auf dem Album diesmal also auch „ganze Songs“ drauf und nicht nur Versatzstücke davon. Georgia Anne Muldrow war ja schon immer bereit, den einen oder anderen Bruch einzustreuen, wenn sie der Meinung war, mit einem Song alles gesagt zu haben. Diese Konsequenz ist beeindruckend. Und ebenso ihr musikalisches Gespür. Wie sie den zahlreichen Gaststars ein musikalisches Korsett schafft, das auch vor abwegigen Einfällen nicht halt macht, das ringt einem schon Respekt ab. In künstlerischer Hinsicht jedenfalls ist sie längst Weltspitze. Und wer weiß, vielleicht gelingt ihr ja mit diesem Album endlich der längst verdiente Durchbruch.
„Hallo Angst, du Arschloch!“ prescht es einem derweil entgegen im Opener der neuen Scheibe von Jupiter Jones. So muss ein Album losgehen. Fast scheint es, als wollten die Jungs der massentauglichen Anbiederung ihres letzten Albums ein fettes… „nicht mit uns“ entgegenschleudern. „Holiday in Catatonia“ führt die Band, wie schon die vorab veröffentlichte EP, zurück zu alter Stärke. Die neue Single „Das Jahr in dem ich schlief“ – ein pathetischer Kracher. Aber wie sagte Thees Uhlmann so schön: „du nennst es Pathos und ich nenn es Leben“. Kurz gesagt: es macht wieder Spaß, den Jungs dabei zuzusehen, wie sie sich leidenschaftlich durch die Untiefen ihres Seelenlebens wühlen. „Du und Jörg Haider“ wagt den Aufstand zusammen mit Ingo von den Donots und auch das anfangs etwas langatmig anmutende „Nordpol/Südpol“ mit Jana Pallaske entfaltet nach einigen Durchläufen durchaus seinen Charme. Alles in allem lässt sich abschließend also zusammenfassen: Jupiter Jones haben mit „Holiday In Catatonia“ noch mal die Kurve gekriegt. Alle die dachten, die Jungs würden sich nach dem Vorgänger bald zu den neuen Pur entwickeln, kriegen von diesen Songs voll eins in die Fresse verpasst. Gut gemacht!
Und wie heißt es so schön im Geschreibsel zum neuen Album von Kiki alias Joakim Ijäs. „Kaiku“ ist das finnische Wort für „Echo“. Und dieses Echo knallt rein. Das Feuerwerk für den Club wird diesmal allerdings subtil von schwelgerischen Klängen umwoben („Starslider“) oder von Downbeat-Ausflügen gekontert (No Words Neccessary“). Das wirkt dann einerseits äußerst dynamisch. Vor allem aber sorgt es für euphorische Momente, wenn hin und wieder der Holzhammer ausgepackt wird und alle Regler auf die Tanzfläche zielen. Alles in allem kann man sich zu „Kaiku“ vor allem fallen lassen. Die Szenerien im Club manifestieren sich in Kikis Klängen, als wollte die Musik ein von Nebel überdecktes Gemälde einer detailreichen Tanzlandschaft generieren. Man verliert sich völlig im Zauber des Moments und lässt sich von dem Sog der Klänge treiben. Die Augen schließen sich und die Gegenwart verschwimmt mit der Erinnerung. Zusammen entsteht etwas Mitreißendes. Der Puls der Musik führt einen weiter hinein in die detailreichen Klanglandschaften. Und sorgt so letztlich für berauschende Momente, die ebenso schwer in Worte zu fassen sind, wie die Silhouette auf dem brillanten Frontcover mit bloßen Händen zu erhaschen ist.
Was sich die Jungs von Jerx derweil beim Einspielen ihres neusten Albums „See U Soon“ gedacht haben, bleibt auf ewig hinter dem bezeichnenden Covermotiv verschollen. Die Zeiten, in denen man bedenkenlos zu Limp Bizkit und Konsorten im Takt hüpfen konnte, sollten eigentlich längst vorbei sein. Oder hab ich einfach nur den Schrei nicht gehört? „Break Your Fucking Face Tonight“ und so… brauchen wir da wirklich ein 2009er Update von? Brauchen wir noch eine von diesen Kapellen, die das Publikum zum Massenhochspringen anregt, als wollten sie unter Beweis stellen: die Guano Apes waren vielleicht doch nicht das unterste Ende der Fahnenstange. Versteht mich bitte nicht falsch: ich habe nichts gegen geile Partymucke, aber wenn in „Pleased To Meet You“ textliche Ergüsse der Marke „This Seems To Be My Lucky Day, Anything More That I Need To Say. I Will Love You To The Very End, But What Was Your Name Again?” in Endlosschleife aus den Boxen hageln, wie Feuerwerkskörper auf Abwegen, dann verzieh ich mich doch lieber in mein Zimmer und verweigere mich der großen Sause. Spätestens nach dem tollen, zweiten Album von Thumb war zu dem Thema hier alles gesagt. Also schauen wir mal, was sonst noch so geht…
Fans von Dream Theater und Konsorten sollten mal in das neue Werk von IQ reinhören. Die Progressive Rock Combo konnte 2004 schon ordentlich abräumen, als sie in zahlreichen Szenemagazinen mit der Nummer eins in den Jahrescharts bedacht wurde. Der Grund dafür: ihr damaliges Album „Dark Matter“, das im Prog-Bereich hohe Wellen schlug. Über zwei Jahre haben die Jungs nun am Nachfolger gefeilt und liefern mit „Frequency“ ein gelungenes Alterswerk ab. Die sieben Songs des Quintetts dürften vor allem Nostalgikern die Tränen in die Augen treiben. Allerdings sollten auch Fans von Iron Maiden durchaus mal einen Durchlauf riskieren. Denkt man sich nämlich den Pathos raus, dazu ein paar schöne Klaviermelodien dazu, landet man genau hier. Im Grenzgebiet zwischen Prog und Pop, was für meinen Geschmack allerdings manchmal zu stark, wie ein Disney-Musical a la „The Lion King“ anmutet.
Der liebe Laurent Garnier überrascht uns hinterher mit einem „mir doch worscht, ob es Stilgrenzen gibt, da scheiß ich doch drauf“-Ballermann. Sein neues Album „Tales Of A Kleptomaniac“ wirkt wie ein Befreiungsschlag. Viele Tracks sind durchzogen von Raps und Gesang und sorgen damit für ein gehöriges Maß an Pop-Appeal. Der französische Acid- und House-DJ war ja schon immer für eine Überraschung gut, aber dass er jetzt auch Jazz-Klänge in die Wagschale wirft, damit hätte man nun wirklich nicht gerechnet. Als wollte er es allen beweisen, schleicht sich sogar der eine oder anderen Drum´n´Bass-Track zwischen die Songs. Allzu chaotisch geht’s dabei aber nicht zu. Alles wirkt so schlüssig verwoben, dass man hinter all dem ein übergeordnetes Konzept vermutet. Getreu dem Motto „alles ist erlaubt“ schenkt uns Mr. Garnier mit diesem Album reinen Wein ein. Legt seine Einflüsse offen. Integriert was muss. Macht was möglich ist (und was nicht). Aber mal ehrlich… wen juckts? Der darf ja eh alles und ist auch diesmal wieder über jede Kritik erhaben. Spätestens, wenn er einem Funkanleihen vor die Füße schmettert, ist man entweder völlig entnervt auf der Suche nach der Stopp Taste oder von solch tiefer Bewunderung ergriffen, dass man sich hoffnungslos in der Musik verfängt. Gleichgültigkeit gibt’s woanders. Selten hat Inkonsequenz so konsequent geklungen. Bei Laurent Garnier gibt’s auch diesmal nur rein oder raus. Und wir sind auch raus für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// von alexander nickel-hopfengart
 Jetzt geht das schon wieder los. Alle von Pitchfork bis zum Observer sind sich einig:
Jetzt geht das schon wieder los. Alle von Pitchfork bis zum Observer sind sich einig: 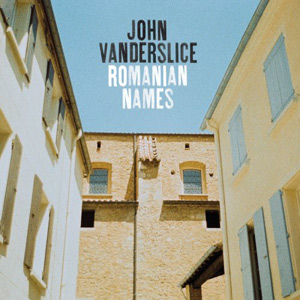 Ähnliches gilt für
Ähnliches gilt für 

 Und weil wir gerade so schön beim Schwärmen sind, widmen wir uns doch mal kurz einem kleinen aber feinen Album namens „Does You Inspire You“. Gute Frage eigentlich, die
Und weil wir gerade so schön beim Schwärmen sind, widmen wir uns doch mal kurz einem kleinen aber feinen Album namens „Does You Inspire You“. Gute Frage eigentlich, die  So wie das von der einfach nur umwerfenden
So wie das von der einfach nur umwerfenden  „Hallo Angst, du Arschloch!“ prescht es einem derweil entgegen im Opener der neuen Scheibe von
„Hallo Angst, du Arschloch!“ prescht es einem derweil entgegen im Opener der neuen Scheibe von 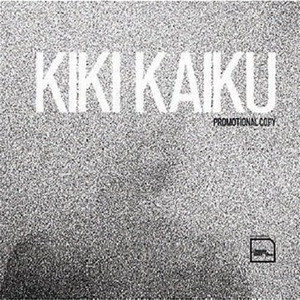 Und wie heißt es so schön im Geschreibsel zum neuen Album von
Und wie heißt es so schön im Geschreibsel zum neuen Album von  Was sich die Jungs von
Was sich die Jungs von  Fans von Dream Theater und Konsorten sollten mal in das neue Werk von
Fans von Dream Theater und Konsorten sollten mal in das neue Werk von  Der liebe
Der liebe
UND WAS NUN?