Der Autor als Fisch, die Musik als Aquarium. So soll es klingen. Das Musikbuch aus dem Hause Dietmar Dath Kammerflimmer Kollektief. „Im erwachten Garten“ will die Musik lesbar machen und das Experiment glückt. Ein subtiler Ambient-Teppich schleicht sich unter die Stimme des Protagonisten – der ehemalige Spex-Chefredakteur und langjährige Kulturkritiker der FAZ erschafft zusammen mit dem Kollektief eine mysteriöse Stimmung, als wollte er dem Sound der Doors die letzte Ehre erweisen. Manchmal wirkt es, als würden die Wortfetzen vom Wüstensand verweht. Der unveröffentlichte Abschnitt seines von der Kritik gefeierten Romans „Die Abschaffung der Arten“ zieht einen von der ersten Sekunde an in seinen Bann. Keine der beiden Parteien drängt sich in den Vordergrund. Stattdessen bekommt das Kollektief immer wieder die Möglichkeit, sich in rein instrumentalen Passagen vollends auszutoben, während Daths gemächliche Zeilen von einem sanften Schleier aus flächigen Sounds umwoben werden. Gerade diese Kontraste hauchen seiner Abhandlung von einer Welt, in der die Tiere den Menschen vor Augen führen, was Liebe und Krieg wirklich bedeutet, einen besonderen Charme ein. Sie machen das Absurde in unserem Leben bildhaft. Und lassen Töne sprechen, wenn Worte nicht mehr zu genügen scheinen.
Ähnlich entrückt geht es auf dem neuesten Werk von La.Mia.Bocca zu. „The Journey“ nimmt einen mit in die Zwischenwelt aus Klassik und Pop. Der Hauch eines elektronischen Klackerns und eine zärtliche, weibliche Stimme lassen anfangs noch befürchten, dass sich hier nach dem subtilen Intro eine Trance-Breitseite der schlimmsten Sorte vor einem aufbäumt. Doch die Angst ist unbegründet. Stattdessen lauscht man Symphonien, minimalistischen Sequenzern, opernhaftem Gesang, indischen Tablas, japanischem Trommeln und umschmeichelnden Chören. Wie allzu oft, wenn jemand versucht, Klassik mit zeitgenössischem Pop zu kombinieren, scheitert dieses Album allerdings an dem hohen Anspruch, eine eigene Sprache aus den gegensätzlichen Spielwiesen zu generieren. Stattdessen wird man immer wieder hin und hergeschleudert zwischen erhabenen Momenten und Passagen, die nur knapp am Klischee vorbei schlittern. Dennoch muss man den Protagonisten hoch anrechnen, es zumindest versucht zu haben. Und wer weiß, sollten sie dran bleiben, vielleicht wird sich ihr Soundentwurf mit den Jahren als wegweißend heraus stellen. Dieser Sound hier jedenfalls steckt noch in den Kinderschuhen, weshalb wir am Ende ein Auge zudrücken, aber dennoch darauf verweisen möchten, dass in der renommierten „Recomposed“-Reihe der Deutschen Grammophon Gesellschaft zuletzt Carl Craig & Moritz von Oswald einen beeindruckenden Ansatz zur Kombination von Elektronik und Klassik aus dem Hut gezaubert haben.
„Alle gegen Alle“ – man ahnt es schon – ist derweil den verehrten Jungs von Slime gewidmet. Der Einfluss der Band ist unbestritten und deswegen haben sich auf der 2fach Tribute Cd auch alle, von den Toten Hosen bis Kreator, von der Rockformation Discokugel bis zu den Ohrbooten. Von den Emils bis zu den Broilers. Von Dimple Minds bis Rastaknast. Ach scheiß doch auf Namedropping. Hier sind alle drauf, die Rang und Namen haben und auch alle, die sich ihren Weg noch durch die Jugendzentren der Cities frei kämpfen. Slime sind auf ihre Weise zu Ikonen geworden, obwohl sie das sicher niemals wollten. Sie haben Marcus Wiebusch von Kettcar genauso beeinflusst, wie Campino und Nagel (Muff Potter). Sie haben eigentlich nur Hits geschrieben – zumindest wenn man Hit als weit nach oben gestreckten Mittelfinger versteht. Sie haben mit „Schweineherbst“ das meiner Meinung nach beste Punkrockalbum aus Deutschland veröffentlicht, wo gibt – eben weil auf dem Album nicht nur inhaltlich alles stimmte, sondern auch musikalisch kaum eine andere Band aus dem Sektor da rankam. Dieses Tributalbum hier ist deshalb auch, wie jedes andere Album dieser Gattung, eine zwiespältige Angelegenheit. Die Songs stehen ja schon in ihrer ursprünglichen Form für sich selbst. Trotzdem ist es bemerkenswert, wie zum Beispiel Rastaknast „Störtebecker“ zum Hängematten-Schunkler umfunktionieren. Oder Dritte Wahl das gelungene „Yankees raus“ wieder beleben. Überhaupt freut man sich, alte Kracher, wie „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“, „Hey Punk“ oder „Linke Spiesser“ mal wieder aufs Neue vor den Latz geknallt zu bekommen. Und kramt spätestens nach Verklingen des letzten Tons in den alten Kassettenkisten, um sich die bahn brechenden Original-Alben der Jungs mal wieder aufs Neue zu Gemüte zu führen. Ach so, bevor ich’s vergesse. Ein schickes Heftchen mit Statements der Bands liegt dem Teil übrigens auch noch bei. Sehr geil zu lesen. Also zugreifen. 50 Songs für umme bekommt man ja nicht alle Tage. Und wie man hört sollen die Jungs auch persönlich bei der Auswahl der Tracks beteiligt gewesen sein.
Wer dann immer noch nicht genug hat, der kann hinterher gleich mal weiterschwitzen. Anti-Flag verabreichen einem mit ihrem siebten Album „The People Or The Gun“ die zeitgemäße Vollbedienung in Sachen Punkrock. Schon der Opener macht klar, bloß weil die Hallen immer größer werden, werden die Jungs nicht unbedingt massenkompatibler. Ein Stück wie „Sodom, Gomorrah, Washington D.C. (Sheep In Shepards Clothing)“ wäre mit dem Wort unbequem noch relativ freundlich umschrieben. Hier schielt jemand nicht unbedingt auf eine möglichst ausgedehnte Präsenz im Formatradio, auch wenn sich immer wieder astreine Hits zwischen die atemlose Tracks schmuggeln. Am Ende muss man eingestehen: Anti-Flag klangen nur selten so wütend, wie in dem brachialen Arschtreter „You Are Fired (Take This Job, Ah, Fuck It.)“. Dazwischen kann man sich zu den grandiosen Hymnen „The Economy Is Suffering… Let It Die“ und „The Gre(a)t Depression“ die Seele aus dem Leib schreien und das System beerdigen. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal ein Album vor mir hatte, das brachialen Rotzpunk so kongenial mit hymnischer Breitseite vermischt. Man hört der Scheibe zu jedem Zeitpunkt an, dass sie eine echte Herzensangelegenheit ist: dazu passt auch, dass die Platte im eigens eingerichteten Studio eingespielt wurde. Alles in allem: Neben dem grandiosen Zweitling von den Riverboat Gamblers der ultimative Sound zum anbrechenden Punkrock-Frühling. Da scheint einem geradewegs die Sonne aus dem Arsch.
Schön auch zu sehen, dass Phoenix endlich wieder mit frischen Melodien am Start sind. Ich sag dir, der Sommer kann kommen, denn „Wolfgang Amadeus Phoenix“ ist wirklich so wunderbar, wie der großspurige Titel verspricht. Eigentlich sind auf der Platte nur Hits drauf. Acht Stücke, die geradezu übersprudeln vor Mitsingrefrains und eingängigen Melodien. Man möchte zu dieser Musik über Wiesen kullern, Purzelbäume schlagen und die Sommersonne anhimmeln. Und weil das alles so luftig leicht ist, wurde im Mittelteil das zweiteilige „Love Like A Sunset“ angesiedelt. Der erste Teil des Songs ufert aus, ändert ständig die Richtung, findet nicht in die Spur zurück (weil hier sowieso keine Struktur erkennbar ist). Und gerade, als man es sich zu den verrauschten Klängen in der Hängematte gemütlich machen will, wird dann im zweiten Teil doch noch so etwas, wie ein kleiner Hit draus. Klein ist hier allerdings wörtlich zu nehmen. Denn nach einer Strophe ist schon wieder Schluss mit lustig und weiter geht’s mit dem Hitfeuerwerk. Keine Ahnung, wie die Jungs das machen. Selbst ein vertracktes Teil, wie „1901“, entpuppt sich als Tanzflächenfüller, weil sie es hinkriegen, die abwegige Struktur des Songs in einen astreinen Sommerrefrain münden zu lassen. Darin liegt wohl auch das Geheimnis dieser Platte. Bei aller Eingängigkeit sind nämlich immer wieder kleine Widerhaken in die Songs eingebaut. Das hält die Spannung aufrecht und sorgt dafür, dass die Scheibe auch nach zahlreichen Durchläufen nicht an Charme verliert. Kurz gesagt: Phoenix haben mit „Wolfgang Amadeus…“ ihr absolutes Meisterwerk abgeliefert. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie die Hitdichte dieses Albums noch mal übertreffen werden.
Und wie geil ist das denn? Cracker sind wieder da. Diese ziemlich locker beschwingte Power Pop Combo, die in den 90ern mal so semi-berühmt die Menschen mit charmanten Melodien beglückte. Jetzt hat sie doch glatt mal ein neues Album am Start. „Sunrise In The Land Of Milk And Honey“ klingt schon vom Titel her nach Schlaraffenland und auch wenn die Band anno 2009 ein bisschen gemächlicher zur Sache geht, als noch vor ein paar Jahren, kann man sich zu Tracks, wie „We All Shine A Light“ und Konsorten noch herrlich den Sonnenhut vom Haupt streifen und fröhlich zum Firmament winken. College-Rock heißt die Vorgabe und weil da derzeit keine große Konkurrenz in Sicht ist, scheint ihnen jetzt schon ein Platz auf den Mixtapes für die Sommerfestivals gesichert. Stilistisch geht’s dabei übrigens ordentlich rund. Folk, Country, Roots Rock und Punk. Alles darf, nichts muss. Die Jungs haben ihren Spaß und das merkt man den Songs auch an. Ob sie damit letztlich die Welt aus den Angeln heben, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber die Wolkenformationen am Himmel verkehren sich schon unverschämt offensichtlich zu einem fetten Grinsen. Wenn der Sommer an die Tür klopft, solltet ihr ihm diese Scheibe mit auf dem Weg geben. Dann wird dieses Jahr jedes Anzeichen von Melancholie gnadenlos zurück geschlagen. Also herzlich Willkommen zurück, Jungs.
Etwas verträumter gehen hinterher Cargo City zu Werke. Ihr neues Album „On.Off.On.Off.“ klingt zu Beginn erstmal weniger weich gespült, als der Vorgänger. Schon im zweiten Song wird ordentlich auf das Schlagzeug eingedroschen, pardon, der Drum-Computer frisiert und dann fröhlich dem beschwingten Frühlingstreiben ein musikalischer Teppich ausgerollt. Das wunderbare „Euphoria/Nostalgia“ transformiert dich mit seinem tanzbaren Sound direkt in den örtlichen Indie-Club. Leider Gottes wird dieses Tempo nicht über die volle Länge durchgehalten. Das macht die Melodien zwar nicht unbedingt schlechter, aber es kommen zunehmend Gedanken an Coldplay auf. Und gegen Mitte des Albums ist dann irgendwie die Luft raus. Gegen Ende können Cargo City dann zwar noch mal mit ein paar akustischen Seelenmassagen punkten und „Rearview Mirror“ reißt einen mit seinen verzerrten Einsprengseln noch mal aus den Tagträumen, doch wenn dann das abschließende „Almost Almost“ leise im Raum verhallt, ist man schon irgendwie froh, dass es vorbei ist. Alle Frühlingsmelancholiker sollten dennoch mal einen Durchlauf riskieren. Es könnte sich lohnen. Alle anderen tanzen sich einfach zu „Euphoria/Nostalgia“ die Haken ab, bis der nächste Smash-Hit den Tanzboden der Indie-Clubs durchflutet.
Wesentlich atemloser und hektischer geht es hinterher auf „The Snake“ zu. Das neue Album von Mariam Wallentin und Andreas Werliin alias Wildbirds &; Peacedrums gerät zu einem abwechslungsreichen Absurditäten-Theater. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen. The Slits treffen Feist und klauen sich eine afrikanische Trommel. Dann wird hin und wieder noch auf ein Xylophon eingedroschen und möglichst zärtlich und beschwipst ins Mikrofon gesäuselt. Und irgendwie entsteht daraus dann Musik. Musik, die so eine gewisse Ahnung davon vermittelt, wie Indie-Pop und Frrejazz eine innige Bindung miteinander eingehen könnten. Komischerweise funktioniert das Ganze überraschend gut. Der Nerv-Pegel ist relativ niedrig. Das wunderbare „Chain Of Steel“ könnte sogar von Björk stammen. Zeigt ihr sogar, was sie auf ihrem letzten Album vor lauter fetten Beats ein bisschen vernachlässigt hat: die passende Hookline nämlich. Wildbirds & Peacedrums machen es einem mit diesem Album sicher nicht immer leicht. Aber sie stehen mit ihrem Sound zumindest schon mal ziemlich allein auf weiter Flur. Und schenkt man ihnen ein wenig Zeit, entpuppt sich ihr Album auch als schicker Wolkenbruch der Emotionen. Ein Confetti-Regen im Musikformat, der für Freunde abseitiger Klänge unbedingt zu empfehlen ist.
Wer sich schon immer mal gewünscht hat, dass die Long Blondes mit Jaguar Love ins Studio hüpfen und Songs von den Futureheads nachspielen, der könnte mit der neuen Scheibe von „Navvy“ äußerst gut bedient sein. Da trifft Synthie-Klatsche auf Gitarrengeschrammel und man kommt nicht umhin, ihnen zumindest in den Blogs eine breite Fanbasis zu prophezeien. Keith, Claire, Daf und Marie sind zudem auch noch aus der Hipster-Brutstätte Sheffield. Was soll da also noch schief gehen? Selbst diejenigen, die „Idyll Intangible“ aus Prinzip scheiße finden wollen, werden sich in den Indie-Dissen des Landes wie wild ihren Körper zu den Songs verrenken. Man kann sich dieser atemlosen Energie einfach nicht entziehen, wenn die Regler erstmal auf Anschlag gedreht sind. Ich jedenfalls habe inzwischen jeden Widerstand aufgegeben und überbrücke mit diesem schmissigen Brüllaffen-Sound die Zeit bis zum nächsten Arctic Monkeys-Album. Denn, wie sagte Peter Fox so großspurig? „Yeah, Baby, schwing dein Teil…“.
Ähnliches, allerdings in etwas gedrosselterem Tempo, ist auch zu den neuen Songs von Wetdog möglich. Die plündern sich allerdings lieber die schönsten Momente der Slits zusammen und vermengen das Ganze mit Sonic Youth zu „Goo“-Zeiten. Fehlt eigentlich nur noch ein klassisches Slacker-Video und fertig ist der süßeste Indie-Traum für alle Jungs und Mädels, die demnächst ein Revival der zerschlissenen Jeans einläuten wollen. „Enterprise Reversal“ gibt ja auch schon namenstechnisch die Richtung vor. Lediglich die Protagonisten wurden ausgetauscht. Sonst bleibt alles gleich. Im Falle Wetdog könnte ich mir aber nun wirklich nichts Schöneres vorstellen. Wenn sich dann in „Stumpy Torso“ auch noch Freejazz-Passagen in die Tracks mogeln, bin ich geneigt, dieser Band hier eine ganz große Zukunft zu prophezeien. Größenwahnsinnig genug sind sie ja schon mal. Warum sonst sollten die mal eben eine 22teilige Tracklist auffahren, die man gut und gerne auch auf zwei Alben hätte verteilen können. Musste eben raus, der Scheiß. Und mal im ernst: wer spart schon gerne in solche schnelllebigen Zeiten. Also Regler rauf und ab dafür.
Der olle Schwerenöter Robin Proper Sheppard alias Sophia hat derweil sein traurigstes Werk der Bandgeschichte veröffentlicht. Vertonter Weltschmerz trifft auf erhabene Popmomente. Oder noch plakativer: Es gibt kein Entrinnen, wenn sich die Musik in den Gehörgängen des Hörers verfängt. Der Auftakt der Scheibe spielt noch mit dem Hörer. Macht ihm Glauben, dass da noch irgendwo ein Hoffnungsschimmer hinter dem Horizont empor kriechen könnte. Aber es bleibt finster. Düster. Nacht. Sophia haben mit „There Are No Goodbyes“ ihre Maske abgelegt. Noch nie schien Robin Proper Sheppard so vollkommen bei sich zu sein. Noch nie klangen seine Stücke so schmerzhaft. Und noch nie war man so begeistert davon, dass er den Mumm hat, einen dabei zusehen zu lassen. Ist irgendwie schon grotesk, dass solch zerstörerische Musik eine solche heilende Wirkung ausstrahlt. Es gibt ja immer wieder Alben, da ist man sich sicher, die mussten geschrieben werden. „There Are No Goodbyes“ ist eines dieser Alben. Das musste raus aus ihm. Das spürt man. Jeder einzelne dieser Songs strotzt nur so vor Hingabe. Vor Gefühl. Man traut sich fast nicht mit Worten über dieses Album zu schreiben, weil man der Musik niemals gerecht werden könnte. Deswegen steht an dieser Stelle jetzt nichts mehr… möge die Musik für sich selbst sprechen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
 Der Autor als Fisch, die Musik als Aquarium. So soll es klingen. Das Musikbuch aus dem Hause Dietmar Dath
Der Autor als Fisch, die Musik als Aquarium. So soll es klingen. Das Musikbuch aus dem Hause Dietmar Dath  Ähnlich entrückt geht es auf dem neuesten Werk von
Ähnlich entrückt geht es auf dem neuesten Werk von  „Alle gegen Alle“ – man ahnt es schon – ist derweil den verehrten Jungs von
„Alle gegen Alle“ – man ahnt es schon – ist derweil den verehrten Jungs von  Wer dann immer noch nicht genug hat, der kann hinterher gleich mal weiterschwitzen.
Wer dann immer noch nicht genug hat, der kann hinterher gleich mal weiterschwitzen. Schön auch zu sehen, dass
Schön auch zu sehen, dass  Etwas verträumter gehen hinterher
Etwas verträumter gehen hinterher 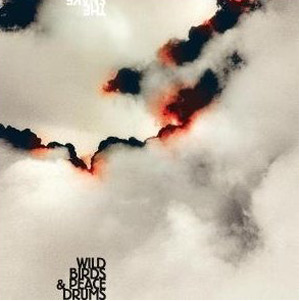 Wesentlich atemloser und hektischer geht es hinterher auf „The Snake“ zu. Das neue Album von Mariam Wallentin und Andreas Werliin alias
Wesentlich atemloser und hektischer geht es hinterher auf „The Snake“ zu. Das neue Album von Mariam Wallentin und Andreas Werliin alias 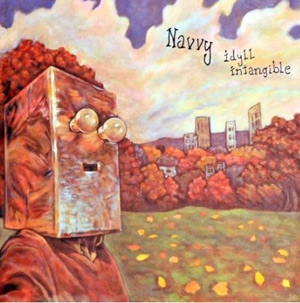 Wer sich schon immer mal gewünscht hat, dass die Long Blondes mit Jaguar Love ins Studio hüpfen und Songs von den Futureheads nachspielen, der könnte mit der neuen Scheibe von „
Wer sich schon immer mal gewünscht hat, dass die Long Blondes mit Jaguar Love ins Studio hüpfen und Songs von den Futureheads nachspielen, der könnte mit der neuen Scheibe von „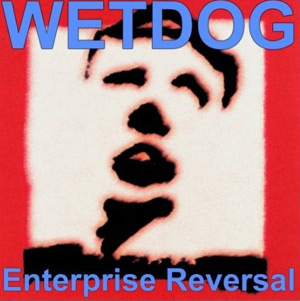 Ähnliches, allerdings in etwas gedrosselterem Tempo, ist auch zu den neuen Songs von
Ähnliches, allerdings in etwas gedrosselterem Tempo, ist auch zu den neuen Songs von 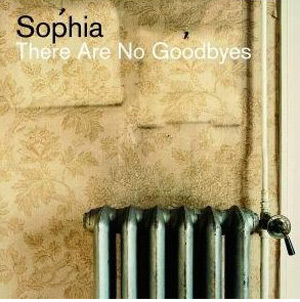 Der olle Schwerenöter Robin Proper Sheppard alias
Der olle Schwerenöter Robin Proper Sheppard alias
UND WAS NUN?