mit den Werken „Drei Wochen im August“ von Nina Bußmann und „Die weissen Nächte“ von Urszula Honek.
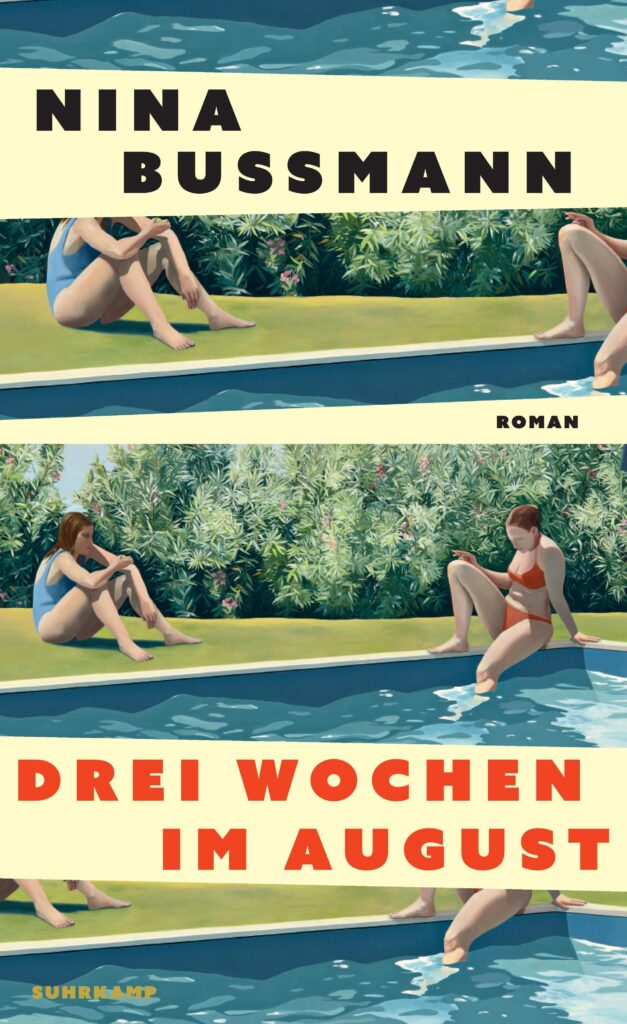
// Nina Bußmanns Drei Wochen im August und Urszula Honeks Die weißen Nächte sind zwei Bücher, die auf den ersten Blick nicht viel gemein haben – ein psychologisch intensiver Sommerroman über ein Familienidyll, das aus den Fugen gerät, und ein literarisch verdichtetes Mosaik von Schicksalen in einem polnischen Dorf. Doch unter der Oberfläche teilen sie eine tiefe thematische Verwandtschaft: Beide erzählen von Menschen, die in fragilen, prekären Zuständen leben, die nach Halt suchen – in Beziehungen, in Erinnerungen, in der Natur – und dabei immer wieder scheitern oder sich verlieren. Und beide Bücher entfalten eine subtile, schleichende Spannung, die sich aus der Frage speist: Wie viel Unerzähltes, Unbewusstes, vielleicht auch Unausweichliches liegt zwischen den Zeilen? In Drei Wochen im August schickt Nina Bußmann ihre Protagonistin Elena an die französische Atlantikküste, um mit ihren Kindern und der Babysitterin Eve eine Auszeit zu nehmen.
Doch das Ferienhaus, das zunächst wie ein sicherer Rückzugsort wirkt, wird schnell zum Schauplatz wachsender Spannungen. Die Hitze, die ausgedörrten Wälder, die nahenden Brände – all das verstärkt das Gefühl, dass etwas Unheilvolles in der Luft liegt. Beziehungen beginnen zu bröckeln, das Misstrauen wächst, unausgesprochene Machtverhältnisse kommen an die Oberfläche. Und schließlich verschwindet eines der Mädchen – eine Eskalation, die nur konsequent erscheint in dieser Atmosphäre des latenten Unbehagens. Bußmanns Sprache ist präzise, kontrolliert, sie legt die psychologischen Mechanismen zwischen den Figuren mit chirurgischer Genauigkeit offen. Dabei interessiert sie sich weniger für die große Eskalation als für die kleinen Verschiebungen, die feinen Risse im scheinbar Selbstverständlichen. Ganz anders erzählt Urszula Honek in Die weißen Nächte, doch auch hier liegt das Unausgesprochene wie ein Schatten über allem. Ihr Roman ist kein linear erzähltes Werk, sondern ein Netz aus miteinander verbundenen Erzählungen, die ein Bild von Menschen am Rand der Gesellschaft zeichnen – einem Dorf in den Beskiden, das von der Stille der Natur umgeben, aber von den Ängsten und Hoffnungen seiner Bewohner erfüllt ist. Da ist das kleine Mädchen, das seine sterbende Großmutter begleitet, ohne zu verstehen, was geschieht.
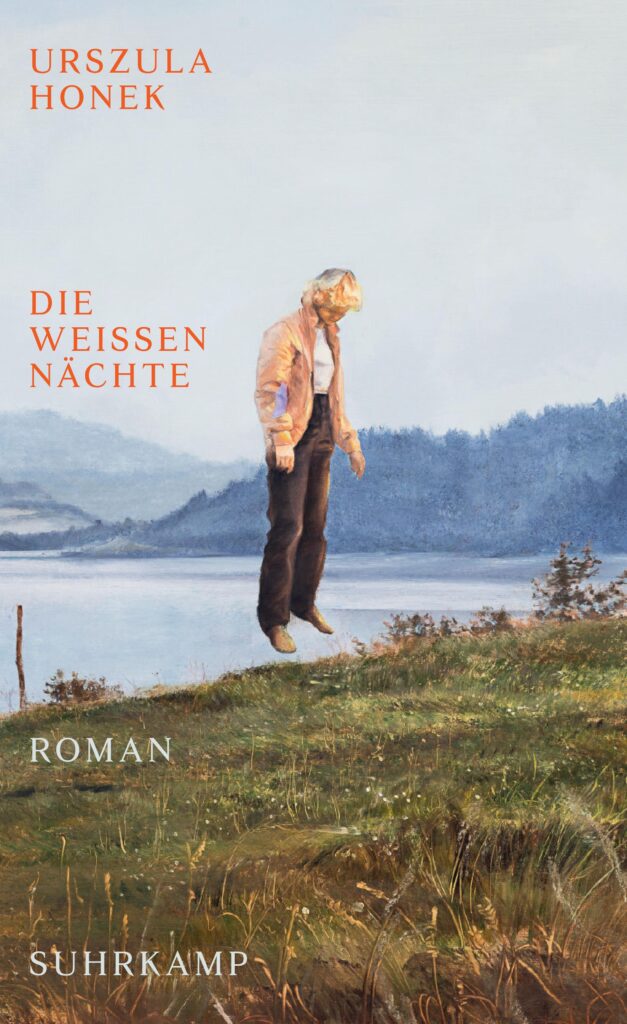
Da sind Freunde, die vor einer ungewissen Zukunft stehen, während der Tod bereits in ihren Herzen wohnt. Da ist die junge Frau, die mehr vom Leben will, als ihr das Dorf bieten kann – und die doch in seiner Schwere gefangen bleibt. Honek schreibt in poetischen, dichten Bildern, ihre Sprache ist gleichzeitig zart und hart, voller Melancholie, aber auch voller Empathie. Was diese beiden Bücher verbindet, ist ihr Gespür für Zwischenräume – für das, was zwischen den Figuren geschieht, ohne dass es ausgesprochen wird. In Bußmanns Roman sind es die unausgesprochenen Konflikte zwischen Elena und ihren Mitbewohnern, die unausgesprochene Spannung zwischen den Erwachsenen und Kindern, die schließlich in eine Katastrophe münden. In Honeks Buch sind es die Erinnerungen, die Geheimnisse, die generationenübergreifenden Schicksale, die sich langsam entfalten, ohne dass sie je vollständig greifbar werden. Beide Romane erzählen von Orten, die für ihre Figuren sowohl Schutz als auch Bedrohung sind: Das Ferienhaus am Atlantik, das von der Hitze und den Bränden bedrängt wird, das Dorf in den Beskiden, das eine Heimat ist, aber auch eine Falle. Beide Werke kreisen um Menschen, die feststecken – sei es in einer zerrütteten Ehe oder in einer kleinstädtischen Enge. Und beide Bücher schaffen es, das Unsichtbare spürbar zu machen: die unterschwelligen Ängste, die diffusen Bedrohungen, die Last der Vergangenheit. Während Drei Wochen im August eher als psychologischer Spannungsroman funktioniert, der mit atmosphärischer Dichte und präziser Figurenzeichnung überzeugt, ist Die weißen Nächte ein fast lyrisches Werk, das von der Kraft der Andeutung lebt. Wo Bußmann mit narrativer Klarheit die Strukturen zwischenmenschlicher Machtverhältnisse analysiert, lässt Honek Raum für Assoziationen, für Leerstellen, für eine fast mythische Erzählweise. Was bleibt nach der Lektüre? Ein Gefühl der Beklemmung, der Ahnung, dass die wirklich wichtigen Dinge immer zwischen den Worten liegen. Dass das, was wir nicht sagen, oft schwerer wiegt als das, was wir aussprechen. Und dass Orte – ob ein abgelegenes Ferienhaus oder ein verschlafenes Dorf – immer auch Spiegel unserer innersten Ängste und Hoffnungen sind.
UND WAS NUN?