mit dem Werken „Für Polina“ und „Ósmann“.
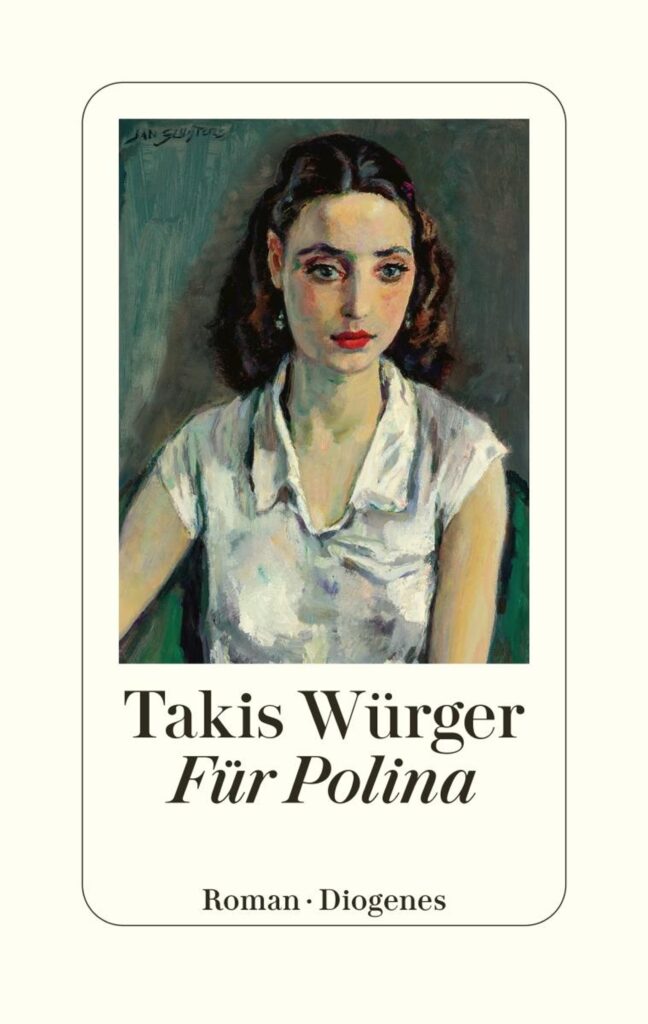
// Zwei Bücher, zwei Autoren – und doch begegnen sie sich in einem tiefen, fast schon existenziellen Sinn: Takis Würgers „Für Polina“ und Joachim B. Schmidts „Ósmann“ erzählen beide von verlorenen Seelen, vom Suchen und Verlorengehen, vom unaufhörlichen Drang, etwas – oder jemanden – wiederzufinden, das dem Leben einst Sinn verlieh. Würgers „Für Polina“ ist eine zarte, schmerzhafte Reise in die Welt der ersten Liebe, der unerfüllten Sehnsucht und der Kraft der Musik. Es ist ein stilles, intensives Buch, das weniger durch Handlung als durch Atmosphäre, Gefühl und sprachliche Reduktion wirkt. Hannes Prager, der Protagonist, trägt seine Liebe zu Polina wie ein flackerndes Licht durch die Dunkelheit seines Lebens. Früh entfremdet vom eigenen Talent, abgeschnitten von der Musik, die ihn mit der Welt und mit sich selbst verband, driftet er in eine Leere ab, aus der er sich erst wieder befreit, als er begreift: Das, was ihn am Leben hielt, war nie vergangen – es war nur verschüttet.
Die Komposition, die er für Polina schrieb, wird zu seinem Kompass, zur letzten Hoffnung auf Erlösung. Ganz anders, und doch tief verwandt, ist „Ósmann“. Joachim B. Schmidt entwirft das Porträt eines Mannes, der nicht nach einer verlorenen Liebe, sondern nach sich selbst sucht – oder vielleicht nach der Ruhe nach einem langen, unermüdlichen Leben. Jón Magnússon Ósmann ist ein Mann der Extreme: gleichzeitig Trinker und Heiler, Fischer und Visionär, ein robuster Realist, der Geister sieht. Island um 1900 ist hier nicht bloß Kulisse, sondern Charakter. Die Natur ist rau, überlebensgroß – wie Jón selbst. Und so, wie Hannes in Würgers Roman in seine Melodie flüchtet, verliert sich Jón in den Weiten des Fjords, in der Einsamkeit, in alten Liedern, in der Erinnerung an die, die er übergesetzt hat – im wörtlichen wie im spirituellen Sinn. Beide Romane sprechen von Abschied – aber auf unterschiedliche Weise. Bei Würger ist es der Abschied von der Unschuld, vom Klang der Kindheit, von einem Gefühl, das nie zur gelebten Liebe wurde.
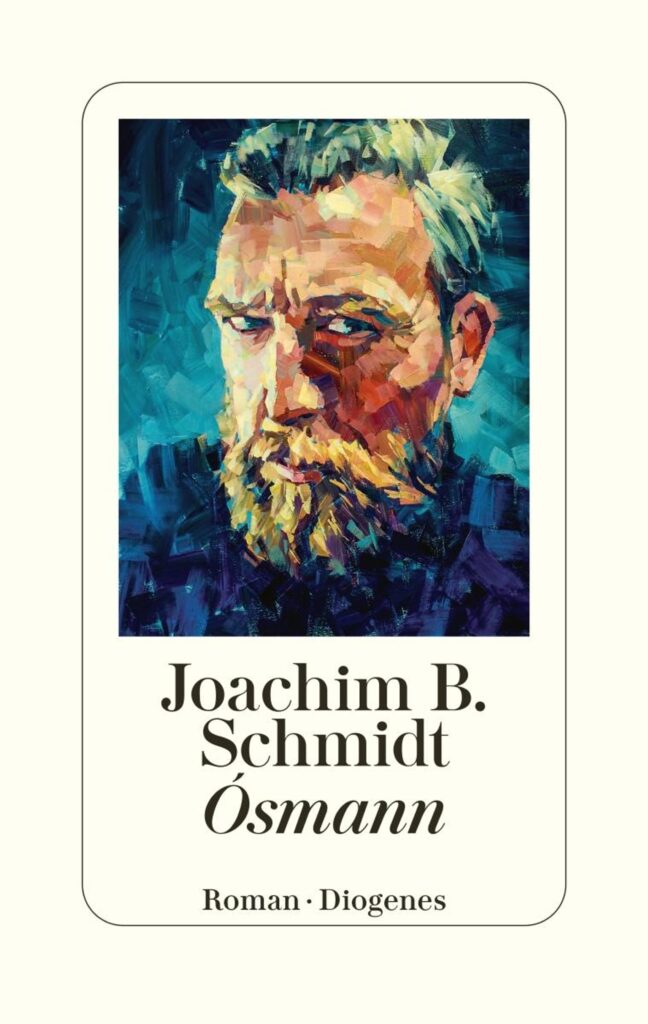
Bei Schmidt ist es der Abschied von der Welt selbst – aber nicht mit Bitterkeit, sondern mit einem seltsamen Frieden. Jón ist kein tragischer Held. Er ist größer als das Leben, vielleicht schon halb Teil der Sagenwelt, die ihn umgibt. Was beide Bücher verbindet, ist ihre Melancholie – aber auch ihre Hoffnung. Hannes Prager glaubt an die Kraft der Musik, an den einen Ton, der alles heilen kann. Jón Ósmann glaubt an das Wasser, das ihn trägt und am Ende vielleicht auch heimholt. Beide kämpfen auf ihre Weise gegen das Vergessen, gegen das Verschwinden. Und sprachlich? Würger ist präzise, fast kühl, seine Sätze sind oft kurz, poetisch, fast schwebend. Er reduziert, wo andere ausschmücken würden. Schmidt hingegen erzählt warm, farbig, mit einer geradezu körperlichen Lust an der Beschreibung, mit nordischer Erzählkraft und einer gewissen mythischen Überhöhung. Diese beiden Werke nebeneinander zu lesen, ist wie ein Gespräch zwischen zwei Welten – einer zivilisierten Innenwelt des Klanges und einer wilden Außenwelt aus Wind, Nebel und Fjorden. Und doch sprechen sie dieselbe Sprache: die der Einsamkeit, des Verlusts – und der Hoffnung, dass ein Mensch, ein Lied, ein Blick oder ein Ufer uns wieder nach Hause führen kann. Zwei kleine Meisterwerke des deutschsprachigen Erzählens – und zwei unvergessliche Männer, die zeigen, dass es manchmal Mut kostet, zu fühlen. Und noch mehr, sich dem Leben trotzdem hinzugeben.
UND WAS NUN?