 Dredg hatten meiner Meinung nach ihre besten Momente auf ihrem Debütalbum „Leitmotif“. Ein solch in sich geschlossenes Werk hatte man nur selten gehört. Es passte alles. Sogar Hits waren drauf, auch wenn sie sich sehr gut hinter dem Gesamtkonzept versteckten. Dredg waren schon damals eine Band auf den zweiten Blick und so verwundert es nicht, dass die Gruppe nun 15 Jahre nach Bandgründung ihren zweiten Frühling erlebt. Das neue Album „The Pariah, The Parrot, The Delusion“ ist dank der radiotauglichen Single „Information“ gerade dabei ein ganz großer Hit zu werden. In kommerzieller Hinsicht scheint also alles gebongt. Doch wie sieht´s mit der Musik aus? Bestens möchte man anmerken, denn Dredg finden mit ihrem neuen Werk wieder zu alter Stärke zurück. Zugegeben. Der Pop wird auf „Pariah“ groß geschrieben. Manche werden sich da ängstlich abwenden, weil sie ein breitenwirksames Rockwerk der Marke Coldplay erwarten. Aber die Scheibe ist von vorne bis hinten schlüssig arrangiert. Die potenziellen Hitsingles „I Don´t Know“ und „Ireland“ fügen sich wie fehlende Puzzleteile ins Gesamtbild ein. Da, wo die Band auf „Catch Without Arms“ noch mit ihrer glatt gebügelten Attitüde zu nerven begann, lassen Dredg diesmal die Melodien sprechen. Die ganze Scheibe ist dermaßen rund geraten, dass man sich schon nach wenigen Songs von jeglichen Vorbehalten befreit. Dredg haben sich mit „Pariah“ nicht etwa dem Mainstream angebiedert, sie haben ihr musikalisches Schaffen auf eine höhere Stufe gesetzt. Dredg machen im Grunde genau das, was sie schon immer tun. Nur, dass die Band sich diesmal die Popwelt als Spielfeld ausgesucht hat. Am Ende reißen dann alle die Hände nach oben. „Pariah“ ist ein triumphaler Sieg über die konventionelle Schmachtfetzenschleuder, die eine Band wie Coldplay immer wieder aufspannt. Damit landet die Gruppe zielsicher im Herzen der Zuhörer.
Dredg hatten meiner Meinung nach ihre besten Momente auf ihrem Debütalbum „Leitmotif“. Ein solch in sich geschlossenes Werk hatte man nur selten gehört. Es passte alles. Sogar Hits waren drauf, auch wenn sie sich sehr gut hinter dem Gesamtkonzept versteckten. Dredg waren schon damals eine Band auf den zweiten Blick und so verwundert es nicht, dass die Gruppe nun 15 Jahre nach Bandgründung ihren zweiten Frühling erlebt. Das neue Album „The Pariah, The Parrot, The Delusion“ ist dank der radiotauglichen Single „Information“ gerade dabei ein ganz großer Hit zu werden. In kommerzieller Hinsicht scheint also alles gebongt. Doch wie sieht´s mit der Musik aus? Bestens möchte man anmerken, denn Dredg finden mit ihrem neuen Werk wieder zu alter Stärke zurück. Zugegeben. Der Pop wird auf „Pariah“ groß geschrieben. Manche werden sich da ängstlich abwenden, weil sie ein breitenwirksames Rockwerk der Marke Coldplay erwarten. Aber die Scheibe ist von vorne bis hinten schlüssig arrangiert. Die potenziellen Hitsingles „I Don´t Know“ und „Ireland“ fügen sich wie fehlende Puzzleteile ins Gesamtbild ein. Da, wo die Band auf „Catch Without Arms“ noch mit ihrer glatt gebügelten Attitüde zu nerven begann, lassen Dredg diesmal die Melodien sprechen. Die ganze Scheibe ist dermaßen rund geraten, dass man sich schon nach wenigen Songs von jeglichen Vorbehalten befreit. Dredg haben sich mit „Pariah“ nicht etwa dem Mainstream angebiedert, sie haben ihr musikalisches Schaffen auf eine höhere Stufe gesetzt. Dredg machen im Grunde genau das, was sie schon immer tun. Nur, dass die Band sich diesmal die Popwelt als Spielfeld ausgesucht hat. Am Ende reißen dann alle die Hände nach oben. „Pariah“ ist ein triumphaler Sieg über die konventionelle Schmachtfetzenschleuder, die eine Band wie Coldplay immer wieder aufspannt. Damit landet die Gruppe zielsicher im Herzen der Zuhörer.
 Placebo geben sich derweil auf ihrem neuen Album „Battle For The Sun“ alle Mühe, die Falten im Gesicht mit einer gehörigen Portion Schmackes zurückzuschlagen. Mit Neuzugang Steve Forrest am Schlagzeug verbannt die Band die dunklen Schatten ihrer Existenz ins Exil und schreibt tatsächlich ihr erstes Sommeralbum. Der Auftakt der Scheibe gerät mit vier potenziellen Hitsingles am Stück dermaßen famos, dass der Rest der Scheibe gegen „Kitty Litter“, „Ashtray Heart“, „Battle For The Sun“ und die tanzwütige Single „For What It´s Worth“ ganz zwangsläufig ein bisschen abfällt. Dennoch kann ich mich nicht erinnern, wann ich seit „Without You I´m Nothing“ und „Black Market Music“ zum letzten Mal so viel Spaß mit einer Placebo-Scheibe hatte. Jedes Mal, wenn man meint, die Band rutscht in Hälfte zwei zurück in alte Gewohnheiten, schält sich irgendwie noch eine überraschende Idee aus den Songs. Das ausladende „Kings Of Medicine“ zum Beispiel meint man bereits nach dreißig Sekunden durchschaut zu haben und dann wird da doch noch so kleiner Piano-Schunkler zum Mitpfeifen draus. Wenn das Trio sich überhaupt mal den dämonischen Seiten des Daseins zuwendet, dann höchstens noch in einer großspurigen Hymne der Marke „Battle For The Sun“. Dieses Album könnte der Band endgültig das Tor zum Weltruhm aufstoßen. Das genau ist laut eigener Aussage ja auch das Ziel von Placebo. Wenn dabei solch famose Songs heraus springen, wie „The Never-Ending Why“ verzeiht man ihnen diese Großkotzigkeit allerdings nur allzu gerne. Der Kampf um den Platz an der Spitze ist eröffnet. Stellt sich nur die Frage, ob die Masse da mitzieht oder sich doch lieber dem Breitwand-Pop von U2 zuwendet. Warten wir´s ab und genießen bis dahin lieber die Songs – denn Sommerhits schmecken ja bekanntlich am Besten, so lange sie heiß sind.
Placebo geben sich derweil auf ihrem neuen Album „Battle For The Sun“ alle Mühe, die Falten im Gesicht mit einer gehörigen Portion Schmackes zurückzuschlagen. Mit Neuzugang Steve Forrest am Schlagzeug verbannt die Band die dunklen Schatten ihrer Existenz ins Exil und schreibt tatsächlich ihr erstes Sommeralbum. Der Auftakt der Scheibe gerät mit vier potenziellen Hitsingles am Stück dermaßen famos, dass der Rest der Scheibe gegen „Kitty Litter“, „Ashtray Heart“, „Battle For The Sun“ und die tanzwütige Single „For What It´s Worth“ ganz zwangsläufig ein bisschen abfällt. Dennoch kann ich mich nicht erinnern, wann ich seit „Without You I´m Nothing“ und „Black Market Music“ zum letzten Mal so viel Spaß mit einer Placebo-Scheibe hatte. Jedes Mal, wenn man meint, die Band rutscht in Hälfte zwei zurück in alte Gewohnheiten, schält sich irgendwie noch eine überraschende Idee aus den Songs. Das ausladende „Kings Of Medicine“ zum Beispiel meint man bereits nach dreißig Sekunden durchschaut zu haben und dann wird da doch noch so kleiner Piano-Schunkler zum Mitpfeifen draus. Wenn das Trio sich überhaupt mal den dämonischen Seiten des Daseins zuwendet, dann höchstens noch in einer großspurigen Hymne der Marke „Battle For The Sun“. Dieses Album könnte der Band endgültig das Tor zum Weltruhm aufstoßen. Das genau ist laut eigener Aussage ja auch das Ziel von Placebo. Wenn dabei solch famose Songs heraus springen, wie „The Never-Ending Why“ verzeiht man ihnen diese Großkotzigkeit allerdings nur allzu gerne. Der Kampf um den Platz an der Spitze ist eröffnet. Stellt sich nur die Frage, ob die Masse da mitzieht oder sich doch lieber dem Breitwand-Pop von U2 zuwendet. Warten wir´s ab und genießen bis dahin lieber die Songs – denn Sommerhits schmecken ja bekanntlich am Besten, so lange sie heiß sind.
 Womit wir bei einer Band angelangt wären, mit der sich die Dinge ähnlich verhalten. Incubus sind, wie auch Placebo, schon immer ein Sonderling im Haifischbecken der Rockmusikszene gewesen. Wo Placebo mit dem Geschlechterrollen spielten und dadurch Klischees aushebelten, brachten Incubus einen ökologisch gefärbten, man könnte fast sagen, weltmusikalischen Ansatz auf die Bühne, was vor allem bei ihren Liveauftritten zu immer wieder wunderbaren Momenten führte. Im Laufe ihrer Karriere kamen dabei auch allerhand Hits zusammen, die nun auf „Monuments And Melodies“ versammelt wurden. Die Band begnügt sich allerdings nicht damit, die ollen Schmonzetten Marke „Drive“, „Anna Molly“, „Pardon Me“ und „Nice To Know You“ in neuer Reihenfolge auf Silberling zu pressen, sie hat auch zwei neue Songs angekarrt, von denen zumindest die Single „Black Heart Inertia“ nach einigen Durchläufen durchaus Hitpotenzial entfaltet. Auf Scheibe zwei werden dazu nach zahlreiche Raritäten versammelt, die durchaus ein gelungenes, eingeständiges Album abgegeben hätten. Midtempo-Rock vom feinsten wird da aufs Tablett gehievt – dazu noch ein netter Tanzbodenhüpfer namens „Let´s Go Crazy“ (meines Wissens im Original von Prince) und fertig ist die Partyplatte. Am Ende bleibt allerdings ein kleiner Wehrmutstropfen. Das wunderbare „A Certain Shade Of Green“ hat es nur als akustische Version auf die Scheibe geschafft. Da wollte wohl jemand die musikalische Frühphase unbemerkt unter den Teppich kehren. Schade eigentlich, der Songs ist nämlich immer noch eine willkommene Abwechslung, wenn die Aggroganten in den Indie Discos zu Limp Bizkit und Konsorten ihre Mähne im Licht des Stroboskops zappeln lassen.
Womit wir bei einer Band angelangt wären, mit der sich die Dinge ähnlich verhalten. Incubus sind, wie auch Placebo, schon immer ein Sonderling im Haifischbecken der Rockmusikszene gewesen. Wo Placebo mit dem Geschlechterrollen spielten und dadurch Klischees aushebelten, brachten Incubus einen ökologisch gefärbten, man könnte fast sagen, weltmusikalischen Ansatz auf die Bühne, was vor allem bei ihren Liveauftritten zu immer wieder wunderbaren Momenten führte. Im Laufe ihrer Karriere kamen dabei auch allerhand Hits zusammen, die nun auf „Monuments And Melodies“ versammelt wurden. Die Band begnügt sich allerdings nicht damit, die ollen Schmonzetten Marke „Drive“, „Anna Molly“, „Pardon Me“ und „Nice To Know You“ in neuer Reihenfolge auf Silberling zu pressen, sie hat auch zwei neue Songs angekarrt, von denen zumindest die Single „Black Heart Inertia“ nach einigen Durchläufen durchaus Hitpotenzial entfaltet. Auf Scheibe zwei werden dazu nach zahlreiche Raritäten versammelt, die durchaus ein gelungenes, eingeständiges Album abgegeben hätten. Midtempo-Rock vom feinsten wird da aufs Tablett gehievt – dazu noch ein netter Tanzbodenhüpfer namens „Let´s Go Crazy“ (meines Wissens im Original von Prince) und fertig ist die Partyplatte. Am Ende bleibt allerdings ein kleiner Wehrmutstropfen. Das wunderbare „A Certain Shade Of Green“ hat es nur als akustische Version auf die Scheibe geschafft. Da wollte wohl jemand die musikalische Frühphase unbemerkt unter den Teppich kehren. Schade eigentlich, der Songs ist nämlich immer noch eine willkommene Abwechslung, wenn die Aggroganten in den Indie Discos zu Limp Bizkit und Konsorten ihre Mähne im Licht des Stroboskops zappeln lassen.
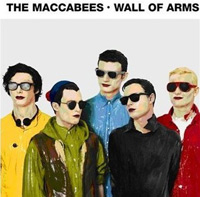 Orlando Weeks (Gesang, Gitarre), Hugo White (Gitarre), Felix White (Gesang, Gitarre), Rupert Jarvis (Bass) und Sam Doyle (Schlagzeug) aus Brighton machen derweil auf ihrem Nachfolger zu „Colour It In“ (2007) dort weiter, wo sie mit dem famosen Vorgänger aufgehört haben. Das erste Album der Jungs war noch am ehesten mit dem Zweitwerk von Maximo Park zu vergleichen – ebenso subtil, wie nachhaltig entpuppten sich die anfangs etwas einfältig wirkenden Songs am Ende als äußerst langlebige Vertreter des zeitgenössischen Indie-Pops. Von wem wir hier reden? Na, The Maccabees natürlich. Diesem sympathischen Quintett aus England, das es hierzulande noch nicht so richtig gerissen hat. „Wall Of Arms“ könnte daran etwas ändern. Die Band scheint sich bei den Aufnahmen in eine Tropfsteinhöhle verzogen zu haben. Das Album ist so düster und tiefgründig geraten, da kriegt man glatt ein bisschen Angst, das gleich eine Horde Vampire aus dem Dunkel auf einen zuhechtet und einem den letzten Tropfen Blut aus den Adern saugt. Ansonsten aber beeindrucken die Jungs mal wieder durch eine dermaßen hohe Hitdichte, dass man geneigt ist, so lange auf einen Blecheimer einzutrommeln, bis auch der letzte vernommen hat, dass hier der heiße Scheiß von gestern den heißesten Scheiß von morgen im Programm hat. Soll heißen: Nach dem Hype ist vor dem Hype. The Maccabees setzen sich mit „Wall Of Arms“ in den oberen Rängen fest. Bleibt nur zu hoffen, dass sie dadurch auch hierzulande den kommerziellen Erfolg einfahren, den sie verdienen. Ich meine, wie lange haben wir auf Worte wie diesen gewartet: „If You Got No Kind Words To Say, You Should Say Nothing More At All”. Viel zu lange…
Orlando Weeks (Gesang, Gitarre), Hugo White (Gitarre), Felix White (Gesang, Gitarre), Rupert Jarvis (Bass) und Sam Doyle (Schlagzeug) aus Brighton machen derweil auf ihrem Nachfolger zu „Colour It In“ (2007) dort weiter, wo sie mit dem famosen Vorgänger aufgehört haben. Das erste Album der Jungs war noch am ehesten mit dem Zweitwerk von Maximo Park zu vergleichen – ebenso subtil, wie nachhaltig entpuppten sich die anfangs etwas einfältig wirkenden Songs am Ende als äußerst langlebige Vertreter des zeitgenössischen Indie-Pops. Von wem wir hier reden? Na, The Maccabees natürlich. Diesem sympathischen Quintett aus England, das es hierzulande noch nicht so richtig gerissen hat. „Wall Of Arms“ könnte daran etwas ändern. Die Band scheint sich bei den Aufnahmen in eine Tropfsteinhöhle verzogen zu haben. Das Album ist so düster und tiefgründig geraten, da kriegt man glatt ein bisschen Angst, das gleich eine Horde Vampire aus dem Dunkel auf einen zuhechtet und einem den letzten Tropfen Blut aus den Adern saugt. Ansonsten aber beeindrucken die Jungs mal wieder durch eine dermaßen hohe Hitdichte, dass man geneigt ist, so lange auf einen Blecheimer einzutrommeln, bis auch der letzte vernommen hat, dass hier der heiße Scheiß von gestern den heißesten Scheiß von morgen im Programm hat. Soll heißen: Nach dem Hype ist vor dem Hype. The Maccabees setzen sich mit „Wall Of Arms“ in den oberen Rängen fest. Bleibt nur zu hoffen, dass sie dadurch auch hierzulande den kommerziellen Erfolg einfahren, den sie verdienen. Ich meine, wie lange haben wir auf Worte wie diesen gewartet: „If You Got No Kind Words To Say, You Should Say Nothing More At All”. Viel zu lange…
 Die Sache mit den Bloc Party Remix Alben hat derweil schon fast eine gewisse Tradition. Manche Tracks wurden gar schon als die besseren Originale abgefeiert. Nun also „Intimacy Remixed“. Ein derbes Elektrobrett mit allerhand Gewalze von Villains („Ares“), Armand van Helden („Signs“) bis hin zu den allseits beliebten Filthy Dukes (verwursten mehr schlecht als recht das wunderbare „One Month Off“). Für Abwechslung sorgen derweil Mogwai mit ihrem famosen Remix von „Biko“. Da ist man sofort auf Wolke sieben und versinkt in einem Strudel aus Tagträumen. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Neuinterpretation von „Better Than Heaven“ geraten. No Age knüppeln den Song regelrecht nieder mit ihrer Wall of Sound. Für die passende Partyatmosphäre sorgen derweil die schmissigen We Have Band mit einem tanzbaren Entwurf von „Halo“. Alles in allem kann man nach dem Genuss dieses Werkes zwar weiter über den Sinn oder Unsinn von Remixalben streiten. Ich sage dennoch: es gibt Schlimmeres. Auch wenn die Scheibe natürlich nicht an das bereits hervorragende Original heranreicht. Der eine oder andere Song wird es demnächst dennoch auf den Tanzflächen der Nation schaffen. Und man wird sich die Backen dazu breit grinsen, weil man weiß, dass gleich alle derbe abgehen, wenn sie die Hookline erkennen.
Die Sache mit den Bloc Party Remix Alben hat derweil schon fast eine gewisse Tradition. Manche Tracks wurden gar schon als die besseren Originale abgefeiert. Nun also „Intimacy Remixed“. Ein derbes Elektrobrett mit allerhand Gewalze von Villains („Ares“), Armand van Helden („Signs“) bis hin zu den allseits beliebten Filthy Dukes (verwursten mehr schlecht als recht das wunderbare „One Month Off“). Für Abwechslung sorgen derweil Mogwai mit ihrem famosen Remix von „Biko“. Da ist man sofort auf Wolke sieben und versinkt in einem Strudel aus Tagträumen. Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Neuinterpretation von „Better Than Heaven“ geraten. No Age knüppeln den Song regelrecht nieder mit ihrer Wall of Sound. Für die passende Partyatmosphäre sorgen derweil die schmissigen We Have Band mit einem tanzbaren Entwurf von „Halo“. Alles in allem kann man nach dem Genuss dieses Werkes zwar weiter über den Sinn oder Unsinn von Remixalben streiten. Ich sage dennoch: es gibt Schlimmeres. Auch wenn die Scheibe natürlich nicht an das bereits hervorragende Original heranreicht. Der eine oder andere Song wird es demnächst dennoch auf den Tanzflächen der Nation schaffen. Und man wird sich die Backen dazu breit grinsen, weil man weiß, dass gleich alle derbe abgehen, wenn sie die Hookline erkennen.
 Und was haben wir denn da? Hat da jemand in einer alten Schatulle eine verschollene Aufnahme der Beach Boys gefunden? Oder ist das doch Beirut auf Bootstour, der sich von den sanften Wogen des Meeres in die weite Welt hinaustreiben lässt. Eins jedenfalls sollte klar sein. Revolver haben sich auf ihrem aktuellen Album „Music For A While“ vollkommen der Nostalgie verschrieben. Nach dem ziemlich verrauschten Auftakt geht es los in Richtung Strandpromenade. Füßchen ins Wasser und mit den Fingern schnippen: lasst uns in schönen Erinnerungen schwelgen zu dieser musikalischen Hommage an Dylan und Sgt. Pepper. An Velvet Underground und die Zombies. An Zeiten, in denen man einfach nur die Augen zu schließen brauchte und dann löste sich die Welt vor einem in Luft an. Revolver schicken einen mit diesem sonnendurchfluteten Trip vierzig Jahre zurück in der Zeit. Dass sie damit heutzutage sicher keinen Innovationspreis mehr gewinnen, sollte genauso klar sein, wie das breite Grinsen, das sich auf den Gesichtern der Zuhörer abzeichnen wird, wenn die Songs den Raum erfüllen. Wer im Sommer einen schönen Platz zum Träumen sucht. Bei Revolver könnte er fündig werden.
Und was haben wir denn da? Hat da jemand in einer alten Schatulle eine verschollene Aufnahme der Beach Boys gefunden? Oder ist das doch Beirut auf Bootstour, der sich von den sanften Wogen des Meeres in die weite Welt hinaustreiben lässt. Eins jedenfalls sollte klar sein. Revolver haben sich auf ihrem aktuellen Album „Music For A While“ vollkommen der Nostalgie verschrieben. Nach dem ziemlich verrauschten Auftakt geht es los in Richtung Strandpromenade. Füßchen ins Wasser und mit den Fingern schnippen: lasst uns in schönen Erinnerungen schwelgen zu dieser musikalischen Hommage an Dylan und Sgt. Pepper. An Velvet Underground und die Zombies. An Zeiten, in denen man einfach nur die Augen zu schließen brauchte und dann löste sich die Welt vor einem in Luft an. Revolver schicken einen mit diesem sonnendurchfluteten Trip vierzig Jahre zurück in der Zeit. Dass sie damit heutzutage sicher keinen Innovationspreis mehr gewinnen, sollte genauso klar sein, wie das breite Grinsen, das sich auf den Gesichtern der Zuhörer abzeichnen wird, wenn die Songs den Raum erfüllen. Wer im Sommer einen schönen Platz zum Träumen sucht. Bei Revolver könnte er fündig werden.
 Wer sich nach dem Sonnenbad noch ein bisschen die Beine vertreten möchte, könnte mit dem neusten Wurf von DJ T. glücklich werden. „The Inner Jukebox“ ist ein astreiner House-Tune mit Gute Laune Garantie. Die Tracks sind subtil genug, um nicht zu nerven und dürften vor allem im Club gut ankommen. DJ T. alias Thomas Koch war ja schon immer einer von den Guten. Als Gründer und Herausgeber des „Groove“-Magazins und Mitbegründer des Berliner Labels „Get Physical“ ist er innerhalb der Szene zur Ikone aufgestiegen. Mit seinem neuen Album setzt er nun auf sein bestes Pferd: ein verdubbter bis atmosphärischer Sound schält sich aus den Boxen und wirft die eine oder andere Hymne für die Tanzgemeinde ab. Innovation heißt hier sein Handwerk zu perfektionieren. DJ T. verlässt sich auf seine Stärken und dürfte damit wieder für reichlich Paarbildung auf dem Tanzboden sorgen. Diese Musik ist nämlich vor allem eins: ausgenommen sexy.
Wer sich nach dem Sonnenbad noch ein bisschen die Beine vertreten möchte, könnte mit dem neusten Wurf von DJ T. glücklich werden. „The Inner Jukebox“ ist ein astreiner House-Tune mit Gute Laune Garantie. Die Tracks sind subtil genug, um nicht zu nerven und dürften vor allem im Club gut ankommen. DJ T. alias Thomas Koch war ja schon immer einer von den Guten. Als Gründer und Herausgeber des „Groove“-Magazins und Mitbegründer des Berliner Labels „Get Physical“ ist er innerhalb der Szene zur Ikone aufgestiegen. Mit seinem neuen Album setzt er nun auf sein bestes Pferd: ein verdubbter bis atmosphärischer Sound schält sich aus den Boxen und wirft die eine oder andere Hymne für die Tanzgemeinde ab. Innovation heißt hier sein Handwerk zu perfektionieren. DJ T. verlässt sich auf seine Stärken und dürfte damit wieder für reichlich Paarbildung auf dem Tanzboden sorgen. Diese Musik ist nämlich vor allem eins: ausgenommen sexy.
 Ganz im Gegensatz zu dem neuen Stoff von Riverside. Da ist rein gar nichts sexy. Außer man steht auf schweißbedeckte Körper, die sich an groovigen Gitarrenklängen abarbeiten. Prog-Rock ist ja gerade der heißeste Gaul der Stunde. Kein Wunder, dass da jeder einmal auf den Buckel rauf möchte, um eine Runde übers Feld zu galoppieren. Riverside stolzieren mit ihren fünf Songs in exakt 44 Minuten und 44 Sekunden so ziellos umher, als suchten sie noch ein Loch im Zaun, durch das sie irgendwie ins Rampenlicht schlüpfen könnten. Leider beackern das Feld der Prog-Musik aber schon einige, weitaus charmantere Acts, die sich noch dazu die unsäglichen New Metal Anleihen verkneifen. Kurz gesagt: nicht mein Fall, dieses Album. Fans des Genres sollten „Anno Domini High Definition“ aber durchaus mal eine Chance geben.
Ganz im Gegensatz zu dem neuen Stoff von Riverside. Da ist rein gar nichts sexy. Außer man steht auf schweißbedeckte Körper, die sich an groovigen Gitarrenklängen abarbeiten. Prog-Rock ist ja gerade der heißeste Gaul der Stunde. Kein Wunder, dass da jeder einmal auf den Buckel rauf möchte, um eine Runde übers Feld zu galoppieren. Riverside stolzieren mit ihren fünf Songs in exakt 44 Minuten und 44 Sekunden so ziellos umher, als suchten sie noch ein Loch im Zaun, durch das sie irgendwie ins Rampenlicht schlüpfen könnten. Leider beackern das Feld der Prog-Musik aber schon einige, weitaus charmantere Acts, die sich noch dazu die unsäglichen New Metal Anleihen verkneifen. Kurz gesagt: nicht mein Fall, dieses Album. Fans des Genres sollten „Anno Domini High Definition“ aber durchaus mal eine Chance geben.
 Ziemlich herrlich gerät derweil der neuste Output aus dem Hause Tortuga Bar. Um die beiden Protagonisten Mark Kowarsch (Sharon Stoned) und Alexandra Gschossmann versammelt sich eine illustre Riege der herzallerliebsten Who Is Whos der Indie-Szene. Evan Dando von den Zironenköpfen, Phillip Boa, Peter von den Sportis, Bernadette La Hengst, Nino von Virginia Jetzt!, Nagel von Muff Potter, Wrongkong und Kate Mosh sind nur eine kleine Auswahl derjenigen, die auf „Narcotic Junkfood Revolution“ ihre Finger mit im Spiel haben. Damit sollte der Hit ja gebucht sein, aber taugt dieses All Star Ensemble auch wirklich was? Oder geht’s bei der Sache vielleicht nur um Namedropping? Mitnichten. Die Scheibe läuft am Stück gut rein. Die Gäste fallen gar nicht groß als solche auf, das ganze klingt eher wie ein groß angelegter Jam von Kollegen, die einfach Bock hatten, mal wieder was Neues zu probieren. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Wer sich das Teil nämlich vor allem wegen seinen persönlichen Lieblinge zulegt, der könnte am Ende herbe enttäuscht sein. Mit dem Output der Hauptbands haben die Songs nämlich in den meisten Fällen rein gar nichts gemein. Trotzdem: Gisbert zu Knyhausen und Evan Dando auf einem Track. Dass ich das noch erleben darf. Herrlich.
Ziemlich herrlich gerät derweil der neuste Output aus dem Hause Tortuga Bar. Um die beiden Protagonisten Mark Kowarsch (Sharon Stoned) und Alexandra Gschossmann versammelt sich eine illustre Riege der herzallerliebsten Who Is Whos der Indie-Szene. Evan Dando von den Zironenköpfen, Phillip Boa, Peter von den Sportis, Bernadette La Hengst, Nino von Virginia Jetzt!, Nagel von Muff Potter, Wrongkong und Kate Mosh sind nur eine kleine Auswahl derjenigen, die auf „Narcotic Junkfood Revolution“ ihre Finger mit im Spiel haben. Damit sollte der Hit ja gebucht sein, aber taugt dieses All Star Ensemble auch wirklich was? Oder geht’s bei der Sache vielleicht nur um Namedropping? Mitnichten. Die Scheibe läuft am Stück gut rein. Die Gäste fallen gar nicht groß als solche auf, das ganze klingt eher wie ein groß angelegter Jam von Kollegen, die einfach Bock hatten, mal wieder was Neues zu probieren. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Wer sich das Teil nämlich vor allem wegen seinen persönlichen Lieblinge zulegt, der könnte am Ende herbe enttäuscht sein. Mit dem Output der Hauptbands haben die Songs nämlich in den meisten Fällen rein gar nichts gemein. Trotzdem: Gisbert zu Knyhausen und Evan Dando auf einem Track. Dass ich das noch erleben darf. Herrlich.
 Ebenso famos ist mal wieder der neue Soundtrack zum diesjährigen Partyprogramm im kargen Industrieambiente vom Melt-Festival. Die Location ist ja sowieso nicht zu überbieten, zumindest in Sachen Atmosphäre, aber wenn dann auch noch Oasis, Phoenix, Bloc Party, Digitalism, die brillanten Fever Ray und Moderat auf der Bühne stehen, weiß man gar nicht zu welcher der vielen Stages man als aller erstes hechten soll. „Melt! V“ versammelt dazu mal wieder alles, was das Indie-Herz begehrt. Neben den oben genannten Acts sind noch Hits von Muff Potter bis Travis, von The Whitest Boy Alive bis The Soundtrack Of Our Lives und von den Foals bis Who Made Who auf dem Silberling versammelt. Das sieht man sich jetzt schon schlaftrunken gen Morgensonne kriechen, um in einen verdienten Dämmerzustand eintauchen. Wer sich schon mal auf die große Sause einstimmen möchte, sollte sich die Scheibe auf keinen Fall entgehen lassen. Kann man auch einfach eins zu eins auf Mixtape überspulen und die Leute damit beeindrucken. Ich sag nur: Hits, Hits, Hits.
Ebenso famos ist mal wieder der neue Soundtrack zum diesjährigen Partyprogramm im kargen Industrieambiente vom Melt-Festival. Die Location ist ja sowieso nicht zu überbieten, zumindest in Sachen Atmosphäre, aber wenn dann auch noch Oasis, Phoenix, Bloc Party, Digitalism, die brillanten Fever Ray und Moderat auf der Bühne stehen, weiß man gar nicht zu welcher der vielen Stages man als aller erstes hechten soll. „Melt! V“ versammelt dazu mal wieder alles, was das Indie-Herz begehrt. Neben den oben genannten Acts sind noch Hits von Muff Potter bis Travis, von The Whitest Boy Alive bis The Soundtrack Of Our Lives und von den Foals bis Who Made Who auf dem Silberling versammelt. Das sieht man sich jetzt schon schlaftrunken gen Morgensonne kriechen, um in einen verdienten Dämmerzustand eintauchen. Wer sich schon mal auf die große Sause einstimmen möchte, sollte sich die Scheibe auf keinen Fall entgehen lassen. Kann man auch einfach eins zu eins auf Mixtape überspulen und die Leute damit beeindrucken. Ich sag nur: Hits, Hits, Hits.
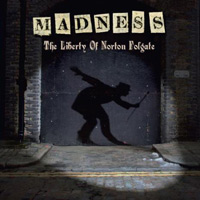 Womit wir dann auch schon wieder zum Ende kommen. Zum Abschluss widmen wir uns noch ein paar älteren Herren, die schon viel zu lange in der Versenkung verschwunden sind. Madness, ja genau, die mit „Our House“, sind wieder da und wer sie zuletzt bei Rock im Park live erleben durfte -wo sie sogar einen doppelten Regenbogen ans Firmament zauberten-, der wird vor Freude auf die Knie fallen und sich einen Kranz aus Blümchen auf den Kopf setzen. Madness sind nämlich nicht, wie von vielen unterstellt, die netten Radiopopper von nebenan. Nein, das ist eine der renommiertesten Ska-Kapellen Englands. Dass sie hierzulande vom Formatradio tot gedudelt wurden, dafür können die Jungs ja nun wirklich nichts. Dabei erstreckt sich ihr musikalisches Schaffen doch über ein breites Sammelsurium an beschwingten Sommerhits, die man sich nur zu gerne zu Gemüte führt, wenn der Schweiß in heißen Tagen von der Stirn purzelt. Im Kreis drehen kann man sich zu „The Liberty Of Norton Folgate“ jedenfalls ganz hervorragend. „NW5“ ist sogar solch ein Anpeitscher, das man sich kurzerhand dazu entschließt, einfach mal drauf los zu purzelbäumen (das Wort wollte ich schon immer mal schreiben). Ihr seht also, auch nach 22 Jahren (hoffentlich habe ich richtig gerechnet) sind die Jungs kein bisschen lebensmüde (oder doch?!). Stattdessen schließen sie mit dem neuen Werk wieder an die Großtaten von früher an, Das zehnminütige Finale des Albums gehört mit zum Besten, was ich in den letzten Jahren an „Ska“-Klängen von der Insel gehört habe. Mit „Norton Folgate“ transferieren sie die hübsche Fassade des gleichnamigen Bezirks im Osten Londons ins heimische Wohnzimmer. Da möchte man sofort die Fenster aufreißen und einen Freiflug auf die Insel nehmen. Madness sind zurück. Und wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Womit wir dann auch schon wieder zum Ende kommen. Zum Abschluss widmen wir uns noch ein paar älteren Herren, die schon viel zu lange in der Versenkung verschwunden sind. Madness, ja genau, die mit „Our House“, sind wieder da und wer sie zuletzt bei Rock im Park live erleben durfte -wo sie sogar einen doppelten Regenbogen ans Firmament zauberten-, der wird vor Freude auf die Knie fallen und sich einen Kranz aus Blümchen auf den Kopf setzen. Madness sind nämlich nicht, wie von vielen unterstellt, die netten Radiopopper von nebenan. Nein, das ist eine der renommiertesten Ska-Kapellen Englands. Dass sie hierzulande vom Formatradio tot gedudelt wurden, dafür können die Jungs ja nun wirklich nichts. Dabei erstreckt sich ihr musikalisches Schaffen doch über ein breites Sammelsurium an beschwingten Sommerhits, die man sich nur zu gerne zu Gemüte führt, wenn der Schweiß in heißen Tagen von der Stirn purzelt. Im Kreis drehen kann man sich zu „The Liberty Of Norton Folgate“ jedenfalls ganz hervorragend. „NW5“ ist sogar solch ein Anpeitscher, das man sich kurzerhand dazu entschließt, einfach mal drauf los zu purzelbäumen (das Wort wollte ich schon immer mal schreiben). Ihr seht also, auch nach 22 Jahren (hoffentlich habe ich richtig gerechnet) sind die Jungs kein bisschen lebensmüde (oder doch?!). Stattdessen schließen sie mit dem neuen Werk wieder an die Großtaten von früher an, Das zehnminütige Finale des Albums gehört mit zum Besten, was ich in den letzten Jahren an „Ska“-Klängen von der Insel gehört habe. Mit „Norton Folgate“ transferieren sie die hübsche Fassade des gleichnamigen Bezirks im Osten Londons ins heimische Wohnzimmer. Da möchte man sofort die Fenster aufreißen und einen Freiflug auf die Insel nehmen. Madness sind zurück. Und wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
UND WAS NUN?