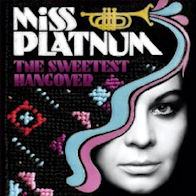 Na dann, Vorhang auf für das nächste Sternchen am Popstarhimmel, das darauf wartet das gleichförmige Chartgedudel mit einer gehörigen Portion Schmackes zurückzuschlagen. Miss Platnum hat mit „The Sweetest Hangover“ einen schillernden kleinen Verrecker von Soul-Pops Gnaden angekarrt und sorgt nun dafür, dass endlich was nachkommt aus Winehouse-schen Gefilden, dass nicht so Duffy-like im Mainstream andockt. Versteht mich bitte nicht falsch: dieses Album hier ist Pop. Tanzbar, urban und zeitgeistig. Aber verdammt noch mal, Miss Platnum sorgt dafür, dass kein Heer aus Produzenten ihre Ideen glatter bügelt, als Kleiderhaken. Dementsprechend erfreut sie uns mit einen imposanten Mix aus R´N´B und Blechgeblase. Sogar Kate Bush darf gecovert werden, ohne dass das aufgesetzt wirken würde. Nein, Miss Platnum ist eine von den Guten. Eine von denen, die viel zu lange in der zweiten Reihe tanzen musste. Es wird nun Zeit ins Scheinwerferlicht zu schreiten. 13 bessere Argumente, als auf „The Sweetest Hangover“ dürften sich dafür kaum finden lassen, auch wenn mir persönlich die treibenden Tracks besser munden, als das balladeske Treiben.
Na dann, Vorhang auf für das nächste Sternchen am Popstarhimmel, das darauf wartet das gleichförmige Chartgedudel mit einer gehörigen Portion Schmackes zurückzuschlagen. Miss Platnum hat mit „The Sweetest Hangover“ einen schillernden kleinen Verrecker von Soul-Pops Gnaden angekarrt und sorgt nun dafür, dass endlich was nachkommt aus Winehouse-schen Gefilden, dass nicht so Duffy-like im Mainstream andockt. Versteht mich bitte nicht falsch: dieses Album hier ist Pop. Tanzbar, urban und zeitgeistig. Aber verdammt noch mal, Miss Platnum sorgt dafür, dass kein Heer aus Produzenten ihre Ideen glatter bügelt, als Kleiderhaken. Dementsprechend erfreut sie uns mit einen imposanten Mix aus R´N´B und Blechgeblase. Sogar Kate Bush darf gecovert werden, ohne dass das aufgesetzt wirken würde. Nein, Miss Platnum ist eine von den Guten. Eine von denen, die viel zu lange in der zweiten Reihe tanzen musste. Es wird nun Zeit ins Scheinwerferlicht zu schreiten. 13 bessere Argumente, als auf „The Sweetest Hangover“ dürften sich dafür kaum finden lassen, auch wenn mir persönlich die treibenden Tracks besser munden, als das balladeske Treiben.
 Und weil wir uns gerade so schön wohl fühlen, drehen wir hinterher die Bassboxen noch ein bisschen weiter auf und freuen uns auf den neuesten Wurf von E-Pop-Darling Lady Sovereign. Die hat ja zuletzt nicht so die tollen Erfahrungen im Mainstream-Gewässer gesammelt, jetzt aber ist sie zurück und strotzt nur so vor Energie. Die etwas glatt geratene Produktion des Vorgängers ist dabei zwar nicht vollends aus dem Soundkorsett der werten Dame verschwunden, aber zwischen Cure-Referenzen („So Human“) und hittigem Geballer („I Got You Dancing“) darf endlich mal wieder mir frecher Schnauze drauf los gepoltert werden, bis sich die Beine wie von selbst in den nimmermüden Schwanz eines hyperaktiven Wackel Dackels transformieren. Soll heißen: die zehn Tracks hier sind so schweißtreibend, dass man sich fragt, warum die charmante Dame nicht schon längst die Kate Nashs und Duffys vom Popmusikthron gerissen hat. Dabei geht’s zwar nicht ganz so offenherzig zu, wie bei der werten Amanda Blank, aber gerade diese Lausbuben-Naivität macht die Sache auch beim zehnten Durchlauf noch spannend, wenn der A-ha-Effekt verflogen ist. „Jigsaw“ ist damit in gewisser Weise der popmusikalische Pendant zur nimmer endenden wollenden „Saw“-Reihe. Aus den einzelnen Tracks ergibt sich am Ende ein schlüssiges Gesamtbild. Dazwischen knallt´s, wie Hölle. Miss Sovereign, so kann´s weitergehen.
Und weil wir uns gerade so schön wohl fühlen, drehen wir hinterher die Bassboxen noch ein bisschen weiter auf und freuen uns auf den neuesten Wurf von E-Pop-Darling Lady Sovereign. Die hat ja zuletzt nicht so die tollen Erfahrungen im Mainstream-Gewässer gesammelt, jetzt aber ist sie zurück und strotzt nur so vor Energie. Die etwas glatt geratene Produktion des Vorgängers ist dabei zwar nicht vollends aus dem Soundkorsett der werten Dame verschwunden, aber zwischen Cure-Referenzen („So Human“) und hittigem Geballer („I Got You Dancing“) darf endlich mal wieder mir frecher Schnauze drauf los gepoltert werden, bis sich die Beine wie von selbst in den nimmermüden Schwanz eines hyperaktiven Wackel Dackels transformieren. Soll heißen: die zehn Tracks hier sind so schweißtreibend, dass man sich fragt, warum die charmante Dame nicht schon längst die Kate Nashs und Duffys vom Popmusikthron gerissen hat. Dabei geht’s zwar nicht ganz so offenherzig zu, wie bei der werten Amanda Blank, aber gerade diese Lausbuben-Naivität macht die Sache auch beim zehnten Durchlauf noch spannend, wenn der A-ha-Effekt verflogen ist. „Jigsaw“ ist damit in gewisser Weise der popmusikalische Pendant zur nimmer endenden wollenden „Saw“-Reihe. Aus den einzelnen Tracks ergibt sich am Ende ein schlüssiges Gesamtbild. Dazwischen knallt´s, wie Hölle. Miss Sovereign, so kann´s weitergehen.
 Und bei wem auch immer der Name My Awesome Mixtape schlimme Gedanken an die immer gleichförmiger agierende Szene aus dem Emo-Hausen wachruft. Er sollte vielleicht doch mal genauer hinhören. Die Italiener haben nicht viel am Hut mit dem gleichförmigen und glatt produzierten Geklöppel der geschminkten Glückseligkeit. Nach dem 2008er Debüt „My Lonely And Sad Waterloo“ versuchen sie sich auf „How Could A Village Turn Into A Town“ an Rockmusik gepaart mit Klangexperimenten. Die Melodien wirken zwar hin und wieder seltsam abstrakt, aber immer wieder schieben sich astreine Hits, wie „How The Feet Touch The Ground“ und „Familiy Portrait“ (und nein, das hat hier wirklich nichts mit Pink! zu tun) zwischen die detailreichen Entwürfe und sorgen für romantische Schlachtgesänge beim Indie-Publikum. Mit jedem Durchlauf entblättern sich die Tracks zu einer homogenen Masse, die man sich am Besten bei geöffnetem Schiebedach und ausgestreckten Armen unter dem blauen Himmelszelt zu Gemüte führt. „How Could A Village Turn Into A Town“ ist ein echtes Sommeralbum, auch wenn man das erst nach dem fünften Durchlauf merkt. Die größte Stärke dieser Scheibe liegt in ihrer Langlebigkeit. Alle Fans von The Faint und Konsorten sollten unbedingt mal reinhören.
Und bei wem auch immer der Name My Awesome Mixtape schlimme Gedanken an die immer gleichförmiger agierende Szene aus dem Emo-Hausen wachruft. Er sollte vielleicht doch mal genauer hinhören. Die Italiener haben nicht viel am Hut mit dem gleichförmigen und glatt produzierten Geklöppel der geschminkten Glückseligkeit. Nach dem 2008er Debüt „My Lonely And Sad Waterloo“ versuchen sie sich auf „How Could A Village Turn Into A Town“ an Rockmusik gepaart mit Klangexperimenten. Die Melodien wirken zwar hin und wieder seltsam abstrakt, aber immer wieder schieben sich astreine Hits, wie „How The Feet Touch The Ground“ und „Familiy Portrait“ (und nein, das hat hier wirklich nichts mit Pink! zu tun) zwischen die detailreichen Entwürfe und sorgen für romantische Schlachtgesänge beim Indie-Publikum. Mit jedem Durchlauf entblättern sich die Tracks zu einer homogenen Masse, die man sich am Besten bei geöffnetem Schiebedach und ausgestreckten Armen unter dem blauen Himmelszelt zu Gemüte führt. „How Could A Village Turn Into A Town“ ist ein echtes Sommeralbum, auch wenn man das erst nach dem fünften Durchlauf merkt. Die größte Stärke dieser Scheibe liegt in ihrer Langlebigkeit. Alle Fans von The Faint und Konsorten sollten unbedingt mal reinhören.
 Alle anderen sollten sich vielleicht doch lieber von Sounds der Marke Moloko meets Amy Winehouse an die Hand nehmen lassen. Kurz gesagt: Unbedingt mal „Fruit“ von The Asteroids Galaxy Tour anchecken. Was ist das nur für ein wahnwitziger Mix aus psychedelischem Größenwahn und entspanntem Soulgesang. Dazu noch ein paar stampfende Beats und fertig ist der passende Soundtrack zum B-Movie im Hinterzimmer des Indie-Clubs. Soll heißen: hier kann man sich ganz entspannt aufs Sofa kuscheln und einfach den Rauchschwaden beim Tanzen zusehen. Das Rauchverbot kann uns mal, wenn Songs, wie „The Sun Ain´t Shining No More“ oder das verstrahlte „Crazy“ eine neue Welt kreieren. Die Band schickt einen auf einen wahnwitzigen Trip in eine Welt, wo Pinguine Ringelreih um Palmen tanzen und Fische durch Wüstensand paddeln. Und damit einen dabei nicht langweilig wird, darf natürlich auch mal das Tanzbein geschwungen werden, wie in dem großartigen „Push The Envelope“. Mit seinen famosen Songs hebt The Asteroids Galaxy Tour geradewegs ab in Richtung Firmament, verlässt die Umlaufbahn unserer Gegenwart und schimmert schwerelos im Raum, wie Blubberblasen.
Alle anderen sollten sich vielleicht doch lieber von Sounds der Marke Moloko meets Amy Winehouse an die Hand nehmen lassen. Kurz gesagt: Unbedingt mal „Fruit“ von The Asteroids Galaxy Tour anchecken. Was ist das nur für ein wahnwitziger Mix aus psychedelischem Größenwahn und entspanntem Soulgesang. Dazu noch ein paar stampfende Beats und fertig ist der passende Soundtrack zum B-Movie im Hinterzimmer des Indie-Clubs. Soll heißen: hier kann man sich ganz entspannt aufs Sofa kuscheln und einfach den Rauchschwaden beim Tanzen zusehen. Das Rauchverbot kann uns mal, wenn Songs, wie „The Sun Ain´t Shining No More“ oder das verstrahlte „Crazy“ eine neue Welt kreieren. Die Band schickt einen auf einen wahnwitzigen Trip in eine Welt, wo Pinguine Ringelreih um Palmen tanzen und Fische durch Wüstensand paddeln. Und damit einen dabei nicht langweilig wird, darf natürlich auch mal das Tanzbein geschwungen werden, wie in dem großartigen „Push The Envelope“. Mit seinen famosen Songs hebt The Asteroids Galaxy Tour geradewegs ab in Richtung Firmament, verlässt die Umlaufbahn unserer Gegenwart und schimmert schwerelos im Raum, wie Blubberblasen.
 Eigentlich ging mir die New Model Army früher ja ziemlich auf den Sack. Punk und Folk wollten sich bei mir nie zu einer schlüssigen Einheit zusammen fügen. Jetzt allerdings erklingt der Opener des neuen Albums „Today Is A Good Day“ und dann funktioniert dieses Wechselspiel auf einmal ziemlich gut. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass auf dem neuen Album die Folkeinflüsse ein wenig gedrosselt wurden. Da läuft dann selbst ein Radiorock-Schunkler, wie „Autumn“ ohne Probleme rein. Mit zunehmender Länge allerdings besinnt sich die Band dann wieder auf ihre alten Stärken. Was für mich wiederum heißt, dass ich mich da lieber ausklinge. Trotzdem: wer die Band bereits ins Herz geschlossen hat. Mit „Today Is A Good Day“ dürfte er auch diesmal goldrichtig liegen.
Eigentlich ging mir die New Model Army früher ja ziemlich auf den Sack. Punk und Folk wollten sich bei mir nie zu einer schlüssigen Einheit zusammen fügen. Jetzt allerdings erklingt der Opener des neuen Albums „Today Is A Good Day“ und dann funktioniert dieses Wechselspiel auf einmal ziemlich gut. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass auf dem neuen Album die Folkeinflüsse ein wenig gedrosselt wurden. Da läuft dann selbst ein Radiorock-Schunkler, wie „Autumn“ ohne Probleme rein. Mit zunehmender Länge allerdings besinnt sich die Band dann wieder auf ihre alten Stärken. Was für mich wiederum heißt, dass ich mich da lieber ausklinge. Trotzdem: wer die Band bereits ins Herz geschlossen hat. Mit „Today Is A Good Day“ dürfte er auch diesmal goldrichtig liegen.
 Wolfgang Müller erinnert mich dann im ersten Stück seines Albums „Gegen den Sinn“ verflucht an Hildegard Knef. Vielleicht ist das nur Zufall? Keine Ahnung. Die Musik jedenfalls stimmt nostalgisch. Durch einen Wildwuchs aus Chanson und Folk krabbelt die Stimme des Protagonisten hinauf auf die Bretter, die die Welt bedeuten und entpuppt sich als ebenso vielseitig, wie herzerwärmend. Man braucht, zugegeben, eine gewisse Affinität zum Klangspektrum von Element Of Crime und Konsorten, dann aber offenbart einem dieses Sammelsurium an Songs einen romantischen Platz am Ufer in lauwarmen Sommernächten. Dann nämlich, wenn sich die Lippen der Liebenden im Glanz des Mondscheins langsam einander annähern, dann erscheint einem dieses Album plötzlich wie der Funken, der in wenigen Augenblicken das Drehbuch für eine herzerwärmende Szenerie schreibt. Dieses Album charakterisiert dieses kurz zuvor, dieses bis hier her und doch nicht ganz, oder um es mit dem Worten des Protagonisten selbst zu sagen: „aber seltsam gewiss, dass da mehr ist, mehr als man sehen kann und mehr als man erzählen kann“. Ein Album wie ein Versprechen. Für Träumer, die hoffnungslos in ihrer eigenen Welt versunken sind, weil die Realität ihnen zu absurd erscheint.
Wolfgang Müller erinnert mich dann im ersten Stück seines Albums „Gegen den Sinn“ verflucht an Hildegard Knef. Vielleicht ist das nur Zufall? Keine Ahnung. Die Musik jedenfalls stimmt nostalgisch. Durch einen Wildwuchs aus Chanson und Folk krabbelt die Stimme des Protagonisten hinauf auf die Bretter, die die Welt bedeuten und entpuppt sich als ebenso vielseitig, wie herzerwärmend. Man braucht, zugegeben, eine gewisse Affinität zum Klangspektrum von Element Of Crime und Konsorten, dann aber offenbart einem dieses Sammelsurium an Songs einen romantischen Platz am Ufer in lauwarmen Sommernächten. Dann nämlich, wenn sich die Lippen der Liebenden im Glanz des Mondscheins langsam einander annähern, dann erscheint einem dieses Album plötzlich wie der Funken, der in wenigen Augenblicken das Drehbuch für eine herzerwärmende Szenerie schreibt. Dieses Album charakterisiert dieses kurz zuvor, dieses bis hier her und doch nicht ganz, oder um es mit dem Worten des Protagonisten selbst zu sagen: „aber seltsam gewiss, dass da mehr ist, mehr als man sehen kann und mehr als man erzählen kann“. Ein Album wie ein Versprechen. Für Träumer, die hoffnungslos in ihrer eigenen Welt versunken sind, weil die Realität ihnen zu absurd erscheint.
 Montreal haben sich in den letzten Jahren ja durchaus angeschickt, sich ein sonniges Plätzchen zwischen den Hosen und den Ärzten zu erkämpfen. Der große Durchbruch allerdings war ihnen bisher noch nicht vergönnt. Zumindest in Sachen Mitgrölfähigkeit haben sie nun auf ihrem gleichnamigen neuen Album wieder elf Songs versammelt, die reichlich Argumente für den großen Wurf bieten. Da sie textlich auch ein bisschen zugelegt haben, läuft dann zum Beispiel der klasse Opener „Schade um dich“ schon mal gut rein. Das Plakative wollen oder möchten sie dann zwar auf voller Länge doch nicht vollständig aus dem Bandsound verbannen und trotzdem ist ihr Drittwerk das erste Album, das man zeitweise wirklich toll finden kann. Schön zu sehen, dass die Jungs ihre schicken Melodien nicht mehr mit platter Lyrik zerfetzen. Das verdient Respekt und ich freu mich jetzt mal auf den Nachfolger, der dann aber mal wirklich der große Wurf werden könnte. „Du klingst den ganzen Tag, als obs ein Interview wär, ziehst über die letzten beiden Platten von U2 her…“ Wem solche Sätze jetzt schon gut rein laufen, sollte die Scheibe auf jeden Fall mal anchecken.
Montreal haben sich in den letzten Jahren ja durchaus angeschickt, sich ein sonniges Plätzchen zwischen den Hosen und den Ärzten zu erkämpfen. Der große Durchbruch allerdings war ihnen bisher noch nicht vergönnt. Zumindest in Sachen Mitgrölfähigkeit haben sie nun auf ihrem gleichnamigen neuen Album wieder elf Songs versammelt, die reichlich Argumente für den großen Wurf bieten. Da sie textlich auch ein bisschen zugelegt haben, läuft dann zum Beispiel der klasse Opener „Schade um dich“ schon mal gut rein. Das Plakative wollen oder möchten sie dann zwar auf voller Länge doch nicht vollständig aus dem Bandsound verbannen und trotzdem ist ihr Drittwerk das erste Album, das man zeitweise wirklich toll finden kann. Schön zu sehen, dass die Jungs ihre schicken Melodien nicht mehr mit platter Lyrik zerfetzen. Das verdient Respekt und ich freu mich jetzt mal auf den Nachfolger, der dann aber mal wirklich der große Wurf werden könnte. „Du klingst den ganzen Tag, als obs ein Interview wär, ziehst über die letzten beiden Platten von U2 her…“ Wem solche Sätze jetzt schon gut rein laufen, sollte die Scheibe auf jeden Fall mal anchecken.
 Mofa wiederum sind eine dieser deutschsprachigen Rockbands, die zwar schmissige Songs abliefern, aber textlich leider auf geringem Niveau verreocken. Kettcar und Wir sind Helden haben textlich Maßstäbe gesetzt, Mofa sind derweil eher so die besseren Revolverhelden oder Schröders. Man kann zwar im Gegensatz zu vorher genannten durchaus passabel zu ihren Songs im Kreis hüpfen, muss sich allerdings schnell eingestehen, dass da noch reichlich Luft nach oben ist. Noch dazu dieses Artwork. Kein Wunder, dass keiner mehr Cds kauft bei so einem Anblick. „Punk Rock Fuck Off“… vielleicht ja beim nächsten Mal.
Mofa wiederum sind eine dieser deutschsprachigen Rockbands, die zwar schmissige Songs abliefern, aber textlich leider auf geringem Niveau verreocken. Kettcar und Wir sind Helden haben textlich Maßstäbe gesetzt, Mofa sind derweil eher so die besseren Revolverhelden oder Schröders. Man kann zwar im Gegensatz zu vorher genannten durchaus passabel zu ihren Songs im Kreis hüpfen, muss sich allerdings schnell eingestehen, dass da noch reichlich Luft nach oben ist. Noch dazu dieses Artwork. Kein Wunder, dass keiner mehr Cds kauft bei so einem Anblick. „Punk Rock Fuck Off“… vielleicht ja beim nächsten Mal.
UND WAS NUN?