 Vermummen ist ja in regelmäßigen Abständen immer wieder angesagt hierzulande. Nun haben sich auch die Klangtechniker von BLK JKS ein Herz gefasst und sich mit musikalischen Wurfgeschossen bestückt. Anfangs erinnert einen „After Robots“ noch stark an den letzten Wurf aus dem Hause TV On The Radio. Die Scheibe macht sich aber mit zunehmender Lauflänge immer weniger verdächtig, als Plagiat der übermenschlichen Originale zu agieren. Die jazzig angehauchten Indie-Pop-Songs, vorangetrieben von Chören und bestückt mit afrikanischen Rhythmen und psychedelischen Passagen wirken vielmehr wie ein Jungbrunnen für all jene, die den ollen Kumpel Indie-Rock bereits abgeschrieben hatten. Das Album mutet bisweilen an, wie ein Musical, das unter Einfluss von bewusstseinserweiternden Substanzen entstanden ist. Die Band allerdings verliert trotz aller Experimentierfreude nie den Song aus den Augen und berauscht so den Hörer über die volle Lauflänge. Wer mal wieder guten Jazz getarnt als Indie-Pop hören möchte, der wird BLK JKS zu Füßen liegen, während in seiner Phantasie jegliche Konventionen in die Luft fliegen.
Vermummen ist ja in regelmäßigen Abständen immer wieder angesagt hierzulande. Nun haben sich auch die Klangtechniker von BLK JKS ein Herz gefasst und sich mit musikalischen Wurfgeschossen bestückt. Anfangs erinnert einen „After Robots“ noch stark an den letzten Wurf aus dem Hause TV On The Radio. Die Scheibe macht sich aber mit zunehmender Lauflänge immer weniger verdächtig, als Plagiat der übermenschlichen Originale zu agieren. Die jazzig angehauchten Indie-Pop-Songs, vorangetrieben von Chören und bestückt mit afrikanischen Rhythmen und psychedelischen Passagen wirken vielmehr wie ein Jungbrunnen für all jene, die den ollen Kumpel Indie-Rock bereits abgeschrieben hatten. Das Album mutet bisweilen an, wie ein Musical, das unter Einfluss von bewusstseinserweiternden Substanzen entstanden ist. Die Band allerdings verliert trotz aller Experimentierfreude nie den Song aus den Augen und berauscht so den Hörer über die volle Lauflänge. Wer mal wieder guten Jazz getarnt als Indie-Pop hören möchte, der wird BLK JKS zu Füßen liegen, während in seiner Phantasie jegliche Konventionen in die Luft fliegen.
 Wer derweil auf der Suche nach einem neuen Superstar ist, sollte sich mal die Bewerbungsunterlagen von Benjamin Biolay reinziehen. Dessen neuster Wurf ist wirklich „Superbe“. „Le Superbe“ ist nämlich ein zunehmend größenwahnsinniges Album. Zwei Scheiben groß – 22 Songs lang. Ein Rundumschlag in Sachen Porno-Pop. Tief atmend haucht sich der französische Musiker durch charismatische Songs, ohne dass man auch nur einen einzigen davon missen möchte. Das Schwülstige an seiner Musik versteckt sich diesmal hinter großen Popmomenten. So wirft Biolay nahezu im Drei-Minuten-Takt mit wunderbaren, fast schon beschwingten Popsongs der Marke „Is Aout“ um sich, als wollte er dem Hörer ein Wolkenmeer ausbreiten, in dem er es sich gemütlich machen darf. „Le Superbe“ ist in gewissem Maße Kissenschlacht und Knutschorgie in einem. Ein wattweiches Vergnügen, das anfangs so unscheinbar auf die Herzen der Hörer losgeht, dass man seine wahre Größe erst nach dem zehnten Anlauf durchschaut. Dann aber kommt man nicht mehr los von Biolays Soundtrack zum Wolkenweitsprung. Frau Holle flennt. Regen fällt. Der Fenstersims wird zur Absprung-Schanze. Arme hoch und ab dafür. Alles in allem: ganz großes Kino.
Wer derweil auf der Suche nach einem neuen Superstar ist, sollte sich mal die Bewerbungsunterlagen von Benjamin Biolay reinziehen. Dessen neuster Wurf ist wirklich „Superbe“. „Le Superbe“ ist nämlich ein zunehmend größenwahnsinniges Album. Zwei Scheiben groß – 22 Songs lang. Ein Rundumschlag in Sachen Porno-Pop. Tief atmend haucht sich der französische Musiker durch charismatische Songs, ohne dass man auch nur einen einzigen davon missen möchte. Das Schwülstige an seiner Musik versteckt sich diesmal hinter großen Popmomenten. So wirft Biolay nahezu im Drei-Minuten-Takt mit wunderbaren, fast schon beschwingten Popsongs der Marke „Is Aout“ um sich, als wollte er dem Hörer ein Wolkenmeer ausbreiten, in dem er es sich gemütlich machen darf. „Le Superbe“ ist in gewissem Maße Kissenschlacht und Knutschorgie in einem. Ein wattweiches Vergnügen, das anfangs so unscheinbar auf die Herzen der Hörer losgeht, dass man seine wahre Größe erst nach dem zehnten Anlauf durchschaut. Dann aber kommt man nicht mehr los von Biolays Soundtrack zum Wolkenweitsprung. Frau Holle flennt. Regen fällt. Der Fenstersims wird zur Absprung-Schanze. Arme hoch und ab dafür. Alles in allem: ganz großes Kino.
 Wer zwischendurch mal wieder was Schönes kochen möchte, dem sei in diesen Tagen ein kleiner Abstecher in den örtlichen Punkrock-Buchhandel des Vertrauens empfohlen. Da steht nämlich endlich das neuste Kochbuch aus dem Hause „OX“ in den Regalen. Das „OX-Kochbuch Vier“ besticht mal wieder mit allerhand vegetarischen (und veganen) Appetitanregern. Pasta mit Kastanien und Rosenkohl, Pasta alla Norma, Pasta-Pancackes oder Linsen-Kokos-Curry. Frittiertes Gemüse in Schokoladensoße, D.I.Y.-Fries und Bös Mopped Kuchen. Alles am Start in diesem Almanach der Gaumenfreuden-Glückseligkeiten. Dazu schicke Illustrationen von Veggie-Burgern und Zementmischern und natürlich ein ganzer Haufen Song-Empfehlungen von den Get Up Kids, Alkaline Trio und Social Distortion. Alles wie gehabt also und immer wieder geil. Lasst es euch schmecken.
Wer zwischendurch mal wieder was Schönes kochen möchte, dem sei in diesen Tagen ein kleiner Abstecher in den örtlichen Punkrock-Buchhandel des Vertrauens empfohlen. Da steht nämlich endlich das neuste Kochbuch aus dem Hause „OX“ in den Regalen. Das „OX-Kochbuch Vier“ besticht mal wieder mit allerhand vegetarischen (und veganen) Appetitanregern. Pasta mit Kastanien und Rosenkohl, Pasta alla Norma, Pasta-Pancackes oder Linsen-Kokos-Curry. Frittiertes Gemüse in Schokoladensoße, D.I.Y.-Fries und Bös Mopped Kuchen. Alles am Start in diesem Almanach der Gaumenfreuden-Glückseligkeiten. Dazu schicke Illustrationen von Veggie-Burgern und Zementmischern und natürlich ein ganzer Haufen Song-Empfehlungen von den Get Up Kids, Alkaline Trio und Social Distortion. Alles wie gehabt also und immer wieder geil. Lasst es euch schmecken.
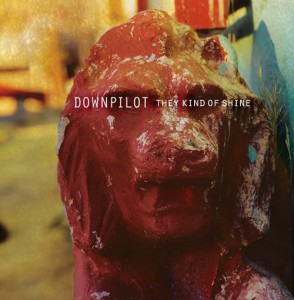 Und gönnt euch hinterher eine entspannte Runde vorm Kamin mit dem neusten Wurf aus dem Hause Downpilot. Anfangs etwas schwülstig anmutend entfaltet diese melancholische Schmonzette nach ein paar Durchläufen durchaus einen Charme, der all die unsäglichen Vergleiche mit Coldplay, Keane und Konsorten ad absurdum führt. Wer sich bei Frank Turner wohl aufgehoben fühlt, sollte „They Kind Of Shine“ durchaus mal ein paar Durchläufe schenken. Geht zwar insgesamt etwas ruhiger zu auf dem Album, aber so ein zeitloses Gestöhne a la „In The Morning“ muss man auch erstmal hinkriegen. Alles in allem viel besser, als erwartet und der perfekte Soundtrack zum Herbst für verträumte Zeitgenossen, die den Punkrocker gerne mal unter der Kuscheldecke verstecken.
Und gönnt euch hinterher eine entspannte Runde vorm Kamin mit dem neusten Wurf aus dem Hause Downpilot. Anfangs etwas schwülstig anmutend entfaltet diese melancholische Schmonzette nach ein paar Durchläufen durchaus einen Charme, der all die unsäglichen Vergleiche mit Coldplay, Keane und Konsorten ad absurdum führt. Wer sich bei Frank Turner wohl aufgehoben fühlt, sollte „They Kind Of Shine“ durchaus mal ein paar Durchläufe schenken. Geht zwar insgesamt etwas ruhiger zu auf dem Album, aber so ein zeitloses Gestöhne a la „In The Morning“ muss man auch erstmal hinkriegen. Alles in allem viel besser, als erwartet und der perfekte Soundtrack zum Herbst für verträumte Zeitgenossen, die den Punkrocker gerne mal unter der Kuscheldecke verstecken.
 Der Zugang zu Anajo ist mir derweil schon seit Jahren verwehrt geblieben. Immer das gleiche mit den Jungs. Nette Songs über nette Menschen, die noch nettere Abende verbringen. Viel Herzschmerz. Großes Kino für die Indie-Disse, Musik für alle, die heute noch zu Virginia Jetzt! die Hüften schwingen. Und nun ja: Jetzt gibt’s die Band auch noch mit Orchester im Schlepptau. Anajo und das Poporchester starten dann auch gleich mit einem Stück, das diesem Rahmen auch angemessen erscheint. „Jungs weinen nicht“, die deutschsprachige Version zum gleichnamigen The Cure-Klassiker, der überraschend wunderbar geraten ist. Überhaupt wirkt das ziemlich gelungen, was die Jungs hier noch mal in veränderter Form aufs Tablett hieven. „Stadt der Frisuren“ könnte in dieser Form durchaus in einem Update des „Schulmädchen“-Reports laufen und „I Don´t Want To Be A Landei“ ist auch nur auf den ersten Blick so peinlich, wie es der Titel vermuten lässt. Alles in allem muss ich bei aller Skepsis gegenüber dieser Band durchaus eingestehen: das Teil hier macht mich zwar noch lange nicht zum Anajo-Anhänger, aber trotzdem verdammt viel Spaß. Jungs und Mädchen. Hört während des Knutschens einfach mal rein.
Der Zugang zu Anajo ist mir derweil schon seit Jahren verwehrt geblieben. Immer das gleiche mit den Jungs. Nette Songs über nette Menschen, die noch nettere Abende verbringen. Viel Herzschmerz. Großes Kino für die Indie-Disse, Musik für alle, die heute noch zu Virginia Jetzt! die Hüften schwingen. Und nun ja: Jetzt gibt’s die Band auch noch mit Orchester im Schlepptau. Anajo und das Poporchester starten dann auch gleich mit einem Stück, das diesem Rahmen auch angemessen erscheint. „Jungs weinen nicht“, die deutschsprachige Version zum gleichnamigen The Cure-Klassiker, der überraschend wunderbar geraten ist. Überhaupt wirkt das ziemlich gelungen, was die Jungs hier noch mal in veränderter Form aufs Tablett hieven. „Stadt der Frisuren“ könnte in dieser Form durchaus in einem Update des „Schulmädchen“-Reports laufen und „I Don´t Want To Be A Landei“ ist auch nur auf den ersten Blick so peinlich, wie es der Titel vermuten lässt. Alles in allem muss ich bei aller Skepsis gegenüber dieser Band durchaus eingestehen: das Teil hier macht mich zwar noch lange nicht zum Anajo-Anhänger, aber trotzdem verdammt viel Spaß. Jungs und Mädchen. Hört während des Knutschens einfach mal rein.
 Auf zwei randvollen Live-Scheiben und einer beiliegenden DVD stimmt einen Paul McCartney derweil ziemlich nostalgisch. „Good Evening New York City“ wirkt wie eine schicke Beatles-Compilation angereichert um einige B-Seiten (besser gesagt: Solo-Songs des Künstlers). „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“, „Helter Skelter“, „Let It Be“, „I Saw Her Standing There“, Yesterday“ und Konsorten. Alle am Start auf diesem Werk, aufgezeichnet an drei Abenden während der Weihung des New Yorkers „Citi Field“, bei der 120.000 Zuschauer am Start waren und da auch ordentlich Spaß hatten. Alles in allem ganz großes Kino von einem der Größten seiner Zunft, der zwar mit seiner Solo-Karriere nie an die Großtaten seiner ehemaligen Band anknüpfen konnte, was allerdings auch für den Rest der Popgeschichte zu gelten hat. Wer sich mal wieder die Zeit mit Zeitlosem vertreiben mag. Einfach diese Scheibe unter den Weihnachtsbaum legen lassen. Der fängt Feuer, Baby.
Auf zwei randvollen Live-Scheiben und einer beiliegenden DVD stimmt einen Paul McCartney derweil ziemlich nostalgisch. „Good Evening New York City“ wirkt wie eine schicke Beatles-Compilation angereichert um einige B-Seiten (besser gesagt: Solo-Songs des Künstlers). „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“, „Helter Skelter“, „Let It Be“, „I Saw Her Standing There“, Yesterday“ und Konsorten. Alle am Start auf diesem Werk, aufgezeichnet an drei Abenden während der Weihung des New Yorkers „Citi Field“, bei der 120.000 Zuschauer am Start waren und da auch ordentlich Spaß hatten. Alles in allem ganz großes Kino von einem der Größten seiner Zunft, der zwar mit seiner Solo-Karriere nie an die Großtaten seiner ehemaligen Band anknüpfen konnte, was allerdings auch für den Rest der Popgeschichte zu gelten hat. Wer sich mal wieder die Zeit mit Zeitlosem vertreiben mag. Einfach diese Scheibe unter den Weihnachtsbaum legen lassen. Der fängt Feuer, Baby.
 Die Oliver Minck Erfahrung führt uns derweil vor Augen, dass Popmusik mit deutschen Texten mehr sein kann, als nur eine bloße Aneinanderreihung von Plattitüden. Zugegeben: die Scheibe steht und fällt mit der Stimme von Oliver Minck, die immer auf dem schmalen Grad zwischen Deutschrock und Olli Schulz hin und herwandelt. Hat man sich allerdings erstmal damit abgefunden, dass die Mucke trotzdem geil ist, entpuppt sich das gleichnamige Album des Songschreibers als gelungene Alternative zu den Tomtes und Kettcars dieser Welt. In „Frustrierter Typ“ nimmt sich Oliver Minck dann passend dazu auch noch Thees Uhlmann zur Brust. Die Eier muss man erstmal haben. Also gilt auch hier: „Mal sehen, wie lange ich noch aufrecht geh?“ Ich hoffe noch etwas länger. Neben dem Erstling von Spaceman Spiff das bisher gelungenste deutschsprachige Album des Jahres. Auch wenn ich auf den nervigen „Popstar“-Track in der Mitte doch gerne verzichtet hätte. Alles in allem: gut gemacht, Herr Minck.
Die Oliver Minck Erfahrung führt uns derweil vor Augen, dass Popmusik mit deutschen Texten mehr sein kann, als nur eine bloße Aneinanderreihung von Plattitüden. Zugegeben: die Scheibe steht und fällt mit der Stimme von Oliver Minck, die immer auf dem schmalen Grad zwischen Deutschrock und Olli Schulz hin und herwandelt. Hat man sich allerdings erstmal damit abgefunden, dass die Mucke trotzdem geil ist, entpuppt sich das gleichnamige Album des Songschreibers als gelungene Alternative zu den Tomtes und Kettcars dieser Welt. In „Frustrierter Typ“ nimmt sich Oliver Minck dann passend dazu auch noch Thees Uhlmann zur Brust. Die Eier muss man erstmal haben. Also gilt auch hier: „Mal sehen, wie lange ich noch aufrecht geh?“ Ich hoffe noch etwas länger. Neben dem Erstling von Spaceman Spiff das bisher gelungenste deutschsprachige Album des Jahres. Auch wenn ich auf den nervigen „Popstar“-Track in der Mitte doch gerne verzichtet hätte. Alles in allem: gut gemacht, Herr Minck.
 Joe Masi würde man nach dem Anblick des blitzeblanken Frontcovers derweil gar nicht zutrauen, dass er ein so schmissiges Werk, wie „Yeah?!“ an den Start zu bringen vermag. Die Scheibe wirkt dennoch vom ersten Ton an wie ein gut bestückter Experimentierkasten und zeigt, was so möglich ist, wenn man als Künstler nur exzentrisch genug ist, seine Ideen kompromisslos umzusetzen. Die Stücke laufen über weite Strecken instrumental vor sich hin, trotzdem wirken viele Töne, als würden sie zum ersten Mal auf diese Weise zusammen gesetzt. Natürlich ist es nahezu unmöglich anno 2009 noch einen Sound zu erschaffen, der befreit von den Geistern der Vergangenheit durch die Fasern der Boxen poltert. Trotzdem bläst Joe Masi mit diesem Album dem eingestaubten Elektro-Genre eine gehörige Portion Staub vom Kopf. Das ist Musik irgendwo zwischen Kraftwerk, Wink, Poltergeist und Lärm-Exzessen. Ein wahrhaft überraschendes Album.Womit wir mal wieder Schluss machen für heute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Joe Masi würde man nach dem Anblick des blitzeblanken Frontcovers derweil gar nicht zutrauen, dass er ein so schmissiges Werk, wie „Yeah?!“ an den Start zu bringen vermag. Die Scheibe wirkt dennoch vom ersten Ton an wie ein gut bestückter Experimentierkasten und zeigt, was so möglich ist, wenn man als Künstler nur exzentrisch genug ist, seine Ideen kompromisslos umzusetzen. Die Stücke laufen über weite Strecken instrumental vor sich hin, trotzdem wirken viele Töne, als würden sie zum ersten Mal auf diese Weise zusammen gesetzt. Natürlich ist es nahezu unmöglich anno 2009 noch einen Sound zu erschaffen, der befreit von den Geistern der Vergangenheit durch die Fasern der Boxen poltert. Trotzdem bläst Joe Masi mit diesem Album dem eingestaubten Elektro-Genre eine gehörige Portion Staub vom Kopf. Das ist Musik irgendwo zwischen Kraftwerk, Wink, Poltergeist und Lärm-Exzessen. Ein wahrhaft überraschendes Album.Womit wir mal wieder Schluss machen für heute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?