 Die Elektro-Sympathen von den Audio Bullys geben sich anno 2010 ziemlich widerborstig, führt man sich die ersten zwei Minuten ihres neuen Albums „Higher Than The Eiffel“ (zu dem Titel sag ich jetzt mal lieber nichts) zu Gemüte. Dann allerdings hauen sie einem wieder einen Tanzboden-Knallfrosch nach dem Nächsten um die Ohren, als wollten sie The Prodigy vor Augen führen, wie man Elektro mit Hooklines vermischt, die sich nicht schon nach drei Durchläufen ausleiern. Soll heißen: es darf wieder euphorisch im Kreis gehüpft werden, aber ab und an auch mal in psychedelische Chemical Brothers-Welten abgedriftet werden. Das lange Warten jedenfalls scheint sich gelohnt zu haben: die Audio Bullys sind mit diesem Album voll im Pop angelangt. Viele der Songs pendeln zwischen den Polen Phoenix und Ian Brown. Da verliert man sich nur zu gerne in den verstrahlten Melodien.
Die Elektro-Sympathen von den Audio Bullys geben sich anno 2010 ziemlich widerborstig, führt man sich die ersten zwei Minuten ihres neuen Albums „Higher Than The Eiffel“ (zu dem Titel sag ich jetzt mal lieber nichts) zu Gemüte. Dann allerdings hauen sie einem wieder einen Tanzboden-Knallfrosch nach dem Nächsten um die Ohren, als wollten sie The Prodigy vor Augen führen, wie man Elektro mit Hooklines vermischt, die sich nicht schon nach drei Durchläufen ausleiern. Soll heißen: es darf wieder euphorisch im Kreis gehüpft werden, aber ab und an auch mal in psychedelische Chemical Brothers-Welten abgedriftet werden. Das lange Warten jedenfalls scheint sich gelohnt zu haben: die Audio Bullys sind mit diesem Album voll im Pop angelangt. Viele der Songs pendeln zwischen den Polen Phoenix und Ian Brown. Da verliert man sich nur zu gerne in den verstrahlten Melodien.
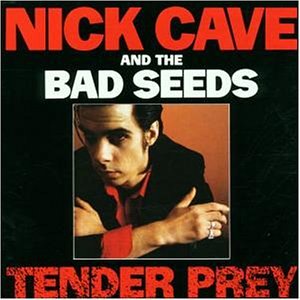 Ein bemerkenswerter Rundumschlag steht uns derweil aus dem Hause Nick Cave & The Bad Seeds bevor. In diesen Tagen erscheinen gleich drei Re-Releases des Goth-Rockers mit seiner betörenden Band im Schlepptau. „Tender Prey“ (1988), „The Good Son“ (1990) und „Henry´s Dream“ (1992) gehören zum Besten, was der Hexenmeister jemals aufgenommen hat. Man fühlt sich regelrecht in Trance versetzt zu dieser Musik, die so nimmermüde, morbide und blutig vor sich hintröpfelt, als hätte jemand ein altes Slasher-Movie in den Videorecorder gesteckt. Der Hörer suhlt sich in düsteren Melodien, die einen auf einen Ritt nach Transsylvanien einladen. Alle drei Alben wurden derweil ergänzt um eine DVD, auf der sich neben Kurzfilmen von Iai
Ein bemerkenswerter Rundumschlag steht uns derweil aus dem Hause Nick Cave & The Bad Seeds bevor. In diesen Tagen erscheinen gleich drei Re-Releases des Goth-Rockers mit seiner betörenden Band im Schlepptau. „Tender Prey“ (1988), „The Good Son“ (1990) und „Henry´s Dream“ (1992) gehören zum Besten, was der Hexenmeister jemals aufgenommen hat. Man fühlt sich regelrecht in Trance versetzt zu dieser Musik, die so nimmermüde, morbide und blutig vor sich hintröpfelt, als hätte jemand ein altes Slasher-Movie in den Videorecorder gesteckt. Der Hörer suhlt sich in düsteren Melodien, die einen auf einen Ritt nach Transsylvanien einladen. Alle drei Alben wurden derweil ergänzt um eine DVD, auf der sich neben Kurzfilmen von Iai n Forsyth und Jane Pollard auch die Alben in aufgemotzter 5.1.-Version wieder finden. Wie Cave und seine Bad Seeds auf „Tender Party“ Garagenrock mit akustischer Gitarre und Klavier vermengen, wie Blixa Bargeld das alles mit seiner Slide-Gitarre in einen Fluss bri
n Forsyth und Jane Pollard auch die Alben in aufgemotzter 5.1.-Version wieder finden. Wie Cave und seine Bad Seeds auf „Tender Party“ Garagenrock mit akustischer Gitarre und Klavier vermengen, wie Blixa Bargeld das alles mit seiner Slide-Gitarre in einen Fluss bri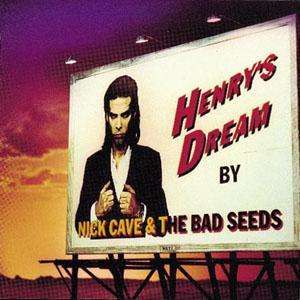 ngt, wie sich brasilianische / afrikanisch Einflüsse auf „The Good Son“ in die Musik einschleichen und Cave das schließlich auf dem nachfolgenden „Henry´s Dream“ nahezu perfekt zusammenführt, um daraus ganz große Popmusik zu kreieren. Das alles noch mal in dieser aufgemotzten Form erleben zu dürfen, sollte jedem Fan die Tränen in die Augen treiben. Wer sich zudem als Neueinsteiger zuletzt am Output von Grinderman erfreute, sonst aber noch nichts von Cave im Regal stehen hat, sollte bei diesen drei Alben hier ansetzen. Es lohnt sich.
ngt, wie sich brasilianische / afrikanisch Einflüsse auf „The Good Son“ in die Musik einschleichen und Cave das schließlich auf dem nachfolgenden „Henry´s Dream“ nahezu perfekt zusammenführt, um daraus ganz große Popmusik zu kreieren. Das alles noch mal in dieser aufgemotzten Form erleben zu dürfen, sollte jedem Fan die Tränen in die Augen treiben. Wer sich zudem als Neueinsteiger zuletzt am Output von Grinderman erfreute, sonst aber noch nichts von Cave im Regal stehen hat, sollte bei diesen drei Alben hier ansetzen. Es lohnt sich.
 Die Donots bringen derweil auf „The Long Way Home“ das Kunststück fertig, den Popappeal ihrer Musik wieder in Richtung der Anfangstage zurück zu drehen. Nachdem man beim letzten Album schon hin und wieder von Beatsteaks- und Billy Talent-Momenten wachgerüttelt wurde, die den bislang ziemlich gleichförmig anmutenden Donots-Kosmos um zahlreiche Facetten erweiterten, hat sich die Band nun dazu entschlossen, den Experimentierkasten aufzuschließen und ein vielseitiges Pop-Punk-Album aufgenommen, das gerade in seinen abseitigen Momenten (wie zum Beispiel in „Dead Man Walking“) besonders mitreißend rüber kommt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wann ich zum letzten Mal eine Scheibe der Jungs so gefeiert habe. Die Melodien sitzen, die Strophen knallen und überhaupt wirkt nichts an diesen elf Tracks lediglich wie schmückendes Beiwerk. Stattdessen gibt’s die volle Dosis Melodien, gepaart mit spannungsreichen Arrangements, die aber niemals den Blick auf den zuckersüßen Popsong dahinter verwischen. Werte Donots, herzlich Willkommen anno zweitausendundzehn.
Die Donots bringen derweil auf „The Long Way Home“ das Kunststück fertig, den Popappeal ihrer Musik wieder in Richtung der Anfangstage zurück zu drehen. Nachdem man beim letzten Album schon hin und wieder von Beatsteaks- und Billy Talent-Momenten wachgerüttelt wurde, die den bislang ziemlich gleichförmig anmutenden Donots-Kosmos um zahlreiche Facetten erweiterten, hat sich die Band nun dazu entschlossen, den Experimentierkasten aufzuschließen und ein vielseitiges Pop-Punk-Album aufgenommen, das gerade in seinen abseitigen Momenten (wie zum Beispiel in „Dead Man Walking“) besonders mitreißend rüber kommt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wann ich zum letzten Mal eine Scheibe der Jungs so gefeiert habe. Die Melodien sitzen, die Strophen knallen und überhaupt wirkt nichts an diesen elf Tracks lediglich wie schmückendes Beiwerk. Stattdessen gibt’s die volle Dosis Melodien, gepaart mit spannungsreichen Arrangements, die aber niemals den Blick auf den zuckersüßen Popsong dahinter verwischen. Werte Donots, herzlich Willkommen anno zweitausendundzehn.
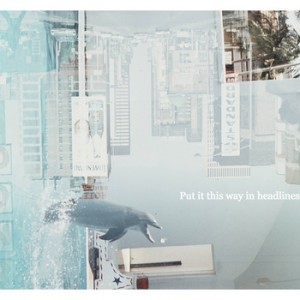 Aerial könnten derweil schon nach wenigen Sekunden all jene glücklich machen, die sich nach herzergreifendem Indie-Pop der Marke Naked Lunch und Monta sehnen, wie Augäpfel nach Tageslicht. „Put It This Way In Headlines“ ist eines dieser Werke, das man nicht unbedingt im Auge hatte auf der Suche nach dem neuen Lieblingsalbum für den anbrechenden Frühling. Wenn sie aber erstmal einige Drehungen auf dem heimischen Plattenteller absolviert hat, möchte man diese Scheibe am liebsten der ganzen Welt vor die Füße knallen. Einfach nur um ihnen allen zu zeigen, was sie denn verpassen, wenn sie diese Musik hier nicht in ihr Herz reinlassen. Aerial klopfen nicht an. Sie packen einen ganz unvermittelt und gehen danach auch so schnell nicht mehr weg. Ein echter Geheimtipp, diese Jungs, Mädels, whatever. Ist ja eigentlich auch egal, wer dahinter steckt, wenn der Sound so stimmig ist, oder etwa nicht?!
Aerial könnten derweil schon nach wenigen Sekunden all jene glücklich machen, die sich nach herzergreifendem Indie-Pop der Marke Naked Lunch und Monta sehnen, wie Augäpfel nach Tageslicht. „Put It This Way In Headlines“ ist eines dieser Werke, das man nicht unbedingt im Auge hatte auf der Suche nach dem neuen Lieblingsalbum für den anbrechenden Frühling. Wenn sie aber erstmal einige Drehungen auf dem heimischen Plattenteller absolviert hat, möchte man diese Scheibe am liebsten der ganzen Welt vor die Füße knallen. Einfach nur um ihnen allen zu zeigen, was sie denn verpassen, wenn sie diese Musik hier nicht in ihr Herz reinlassen. Aerial klopfen nicht an. Sie packen einen ganz unvermittelt und gehen danach auch so schnell nicht mehr weg. Ein echter Geheimtipp, diese Jungs, Mädels, whatever. Ist ja eigentlich auch egal, wer dahinter steckt, wenn der Sound so stimmig ist, oder etwa nicht?!
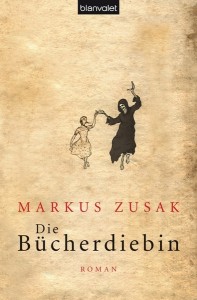 „Die Bücherdiebin“ nennt sich derweil ein sehr „fantastischer“ Roman von Markus Zusak, in dem sich eine neunjährige Protagonistin ihrer Liebe zum geschriebenen Wort bewusst wird und im Jahre 1939 damit beginnt, Bücher zu stehlen. Schön, dass sie dabei auch nicht davor halt macht, Bücher aus den Fängen der Flammen zu stehlen, welche die Nazis geschürt haben. Während Bomben fallen, verliert sich die Protagonistin in einem Paralleluniversum / in den Zeilen der Autoren und kompensiert damit den Verlust ihres Bruders Werner. Natürlich ist „Die Bücherdiebin“ ein Jugendroman, der aber auch für Erwachsene funktioniert. Das Buch liest sich sehr flüssig: „In Liesels Erinnerung war der Himmel in dieser Nacht wie an den Himmel genäht. Drumherum waren Wolken gestickt.“ Dem deutsch-australischen Schriftsteller Zusak dienten bei seinen Ausführungen die Bombenangriffe auf München als Vorlage. Heute unterrichtet er als Englischlehrer an einer amerikanischen Highschool. Sein Roman ist durchzogen von charmanten Illustrationen und bricht hin und wieder mit klassischen Erzählmustern. Alles in allem also durchaus empfehlen, dieses Buch über die nicht enden wollende Faszination für das geschrieben Wort.
„Die Bücherdiebin“ nennt sich derweil ein sehr „fantastischer“ Roman von Markus Zusak, in dem sich eine neunjährige Protagonistin ihrer Liebe zum geschriebenen Wort bewusst wird und im Jahre 1939 damit beginnt, Bücher zu stehlen. Schön, dass sie dabei auch nicht davor halt macht, Bücher aus den Fängen der Flammen zu stehlen, welche die Nazis geschürt haben. Während Bomben fallen, verliert sich die Protagonistin in einem Paralleluniversum / in den Zeilen der Autoren und kompensiert damit den Verlust ihres Bruders Werner. Natürlich ist „Die Bücherdiebin“ ein Jugendroman, der aber auch für Erwachsene funktioniert. Das Buch liest sich sehr flüssig: „In Liesels Erinnerung war der Himmel in dieser Nacht wie an den Himmel genäht. Drumherum waren Wolken gestickt.“ Dem deutsch-australischen Schriftsteller Zusak dienten bei seinen Ausführungen die Bombenangriffe auf München als Vorlage. Heute unterrichtet er als Englischlehrer an einer amerikanischen Highschool. Sein Roman ist durchzogen von charmanten Illustrationen und bricht hin und wieder mit klassischen Erzählmustern. Alles in allem also durchaus empfehlen, dieses Buch über die nicht enden wollende Faszination für das geschrieben Wort.
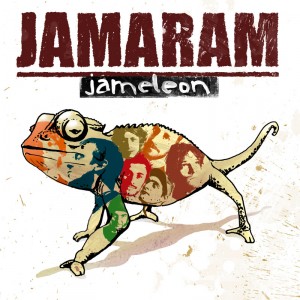 Jamaram machen derweil den „Jameleon“, setzen inzwischen aber auch mal auf deutschsprachige Texte und landen damit irgendwo zwischen Mellow Mark und den Ohrbooten. Klingt allerdings im Gegensatz zu den beiden erstgenannten auf Platte nicht etwa seltsam ausgelutscht, sondern macht auch abseits der großen Bühne derbe viel Spaß. Die spritzigen Solos und die angenehme Leichtigkeit, die Songs wie der gleichnamige Opener oder „Cuenita“ ausstrahlen (das darüber hinaus auch noch mit Mariachi-Anleihen punktet) hängen einem in so trüben Wintertagen eine Sonne vors Gesicht. Der Rest gefällt sich darin, die Sommergitarre mit entspannten Reggae- und Latina-Sounds zu kombinieren und dekliniert noch mal alles durch, was Jamaram zu einem der sympathischsten Reggae-Acts der Gegenwart macht. Der Sommer kommt auch in diesem Jahr. Mit dieser Scheibe kann man ihn noch mal etwas anschieben.
Jamaram machen derweil den „Jameleon“, setzen inzwischen aber auch mal auf deutschsprachige Texte und landen damit irgendwo zwischen Mellow Mark und den Ohrbooten. Klingt allerdings im Gegensatz zu den beiden erstgenannten auf Platte nicht etwa seltsam ausgelutscht, sondern macht auch abseits der großen Bühne derbe viel Spaß. Die spritzigen Solos und die angenehme Leichtigkeit, die Songs wie der gleichnamige Opener oder „Cuenita“ ausstrahlen (das darüber hinaus auch noch mit Mariachi-Anleihen punktet) hängen einem in so trüben Wintertagen eine Sonne vors Gesicht. Der Rest gefällt sich darin, die Sommergitarre mit entspannten Reggae- und Latina-Sounds zu kombinieren und dekliniert noch mal alles durch, was Jamaram zu einem der sympathischsten Reggae-Acts der Gegenwart macht. Der Sommer kommt auch in diesem Jahr. Mit dieser Scheibe kann man ihn noch mal etwas anschieben.
 She´s All That rufen hinterher allerdings mal schlimmer Erinnerungen an Guano Apes wach. Da trifft 80er Keule auf Euro-Dance. Das geht gar nicht. Da fühlt man sich an schlimmste Crossover-Zeiten erinnert, in denen es in Indie-Clubs immer nur darum ging, wer denn jetzt am Lautesten schreit. Ich jedenfalls kann mir Schöneres vorstellen, als mir den Rest des Tages mit „Extra Fruit Disgusting“ zu versauen.
She´s All That rufen hinterher allerdings mal schlimmer Erinnerungen an Guano Apes wach. Da trifft 80er Keule auf Euro-Dance. Das geht gar nicht. Da fühlt man sich an schlimmste Crossover-Zeiten erinnert, in denen es in Indie-Clubs immer nur darum ging, wer denn jetzt am Lautesten schreit. Ich jedenfalls kann mir Schöneres vorstellen, als mir den Rest des Tages mit „Extra Fruit Disgusting“ zu versauen.
 Eagle Seagull machen derweil mal wieder das bessere Shout Out Louds-Album und sollten dafür auch endlich mal den entsprechenden Applaus bekommen. Klatsch, klatsch… klatsch in die Hände. Hüften geschwungen und die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings genossen. „The Year Of How To Book“ ist so ein lebensfroher Springer von Pop-Album, so dass man als Hörer schon nach wenigen Sekunden zum Grashüpfer mutiert und wie wild nach den Halmen in Form von bunten Discolichtern am Clubhimmel hechtet. Die Scheibe bietet im Drei-Minuten-Takt schmissige Rationen für die begierige Indie-Pop-Meute auf den Tanzflächen. Wer keinen Bock mehr auf kalte Wintertage hat, sollte sich diese Herz erwärmenden Melodien über Kopfhörer rein ziehen und sich an den ersten Strahlen der Frühlingssonne erfreuen. Er sollte durch Straßenschluchten stürmen und auf Laternen klettern. Alles scheint möglich zu diesem Sound hier im Tape-Deck. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Eagle Seagull machen derweil mal wieder das bessere Shout Out Louds-Album und sollten dafür auch endlich mal den entsprechenden Applaus bekommen. Klatsch, klatsch… klatsch in die Hände. Hüften geschwungen und die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings genossen. „The Year Of How To Book“ ist so ein lebensfroher Springer von Pop-Album, so dass man als Hörer schon nach wenigen Sekunden zum Grashüpfer mutiert und wie wild nach den Halmen in Form von bunten Discolichtern am Clubhimmel hechtet. Die Scheibe bietet im Drei-Minuten-Takt schmissige Rationen für die begierige Indie-Pop-Meute auf den Tanzflächen. Wer keinen Bock mehr auf kalte Wintertage hat, sollte sich diese Herz erwärmenden Melodien über Kopfhörer rein ziehen und sich an den ersten Strahlen der Frühlingssonne erfreuen. Er sollte durch Straßenschluchten stürmen und auf Laternen klettern. Alles scheint möglich zu diesem Sound hier im Tape-Deck. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?