 Zur Eröffnung lassen wir es heute mal ordentlich krachen. Muss ja schließlich mal gesagt werden, dass Opeth drauf und dran sind, Tool die Krone als charmantester Metal-Act der Gegenwart zu entreißen, der auch in Indie-Discos funktioniert. Das 2001er Debütalbum „Blackwater Park“ wird nun noch mal als schicke Legacy Edition mit Bucheinband auf die Fangemeinde abgefeuert und sorgt dafür, dass schon im Opener gnadenlos die Nackenmuskeln strapaziert werden. Was die Jungs hier in Sachen Dynamik veranstalten, sucht seines Gleichen. Fernab aller Metal-Klischees walzen sie alles platt, was um einen herum auch nur den Hauch frühlingshafter Stimmung aufkommen lässt. Zu diesem Album möchte man ein Sonnenblumenfeld nieder brennen, man möchte einen Maulwurf engagieren, damit er den gepflegten Vorgarten der Nachbarn umgräbt und sich zur beigefügten Dokumentation direkt hinter den Bildschirm stellen, um unmittelbar mitzuerleben, wie diese Klänge das Licht der Welt erblickten. Wer Opeth einmal verfallen ist, kommt so leicht nicht mehr von dieser Band los. Alle, die die Schweden bisher noch nicht auf dem Schirm hatten – alle, die dem Metal-Genre nicht vollkommen abgeneigt gegenüber stehen, sollten unbedingt mal in dieses Album reinhören.
Zur Eröffnung lassen wir es heute mal ordentlich krachen. Muss ja schließlich mal gesagt werden, dass Opeth drauf und dran sind, Tool die Krone als charmantester Metal-Act der Gegenwart zu entreißen, der auch in Indie-Discos funktioniert. Das 2001er Debütalbum „Blackwater Park“ wird nun noch mal als schicke Legacy Edition mit Bucheinband auf die Fangemeinde abgefeuert und sorgt dafür, dass schon im Opener gnadenlos die Nackenmuskeln strapaziert werden. Was die Jungs hier in Sachen Dynamik veranstalten, sucht seines Gleichen. Fernab aller Metal-Klischees walzen sie alles platt, was um einen herum auch nur den Hauch frühlingshafter Stimmung aufkommen lässt. Zu diesem Album möchte man ein Sonnenblumenfeld nieder brennen, man möchte einen Maulwurf engagieren, damit er den gepflegten Vorgarten der Nachbarn umgräbt und sich zur beigefügten Dokumentation direkt hinter den Bildschirm stellen, um unmittelbar mitzuerleben, wie diese Klänge das Licht der Welt erblickten. Wer Opeth einmal verfallen ist, kommt so leicht nicht mehr von dieser Band los. Alle, die die Schweden bisher noch nicht auf dem Schirm hatten – alle, die dem Metal-Genre nicht vollkommen abgeneigt gegenüber stehen, sollten unbedingt mal in dieses Album reinhören.
 Neuen Lesestoff gibt es derweil in Form eines schicken Kindheitsromans, der eben erst den ersten Preis bei der Leipziger Buchmesse einheimste und dabei mit links die werte Helene Hegemann ausstach. Georg Kleins „Roman unserer Kindheit“ spult zurück in die 60er und skizziert humorvoll bis phantastisch, sprachgewaltig und poetisch das Treiben in einer süddeutschen Stadt, erzählt von amerikanischer Kasernen und Gaststätten und zieht den Leser nahezu spielend in seinen Bann, wenn der Roman sich zwischenzeitlich immer wieder an charmanten Sprachbildern ergötzt. Beispiel gefällig? „Durchsetzt von den Rückständen dieses Widerwillens schwebte der Auspuffdunst als eine quecksilbrige Schwade in der klaren kühlen Luft.“ Wem das ein bisschen zu abstrakt ist, der kann sich aber auch einfach an der gelungenen Kindergruselgeschichte erfreuen, die Klein hier in bester Lynch-Manier aus dem Ärmel schüttelt. In gewisser Weise dreht sich der Roman vor allem um die Angst und die Neugier junger Menschen und alles, was in deren Grenzgebiet so geschieht. Die Protagonisten – die „schicke Sybille“, der „Ami-Michi“ oder der „Schniefer“ – durchleben den ganz normalen Wahnsinn der Sommerferien und man genießt dieses Buch, das deutlich macht, welch seltsame Momente das Leben doch für jeden von uns bereit hält. Alles in allem: ein fantastisch mitreißendes Buch.
Neuen Lesestoff gibt es derweil in Form eines schicken Kindheitsromans, der eben erst den ersten Preis bei der Leipziger Buchmesse einheimste und dabei mit links die werte Helene Hegemann ausstach. Georg Kleins „Roman unserer Kindheit“ spult zurück in die 60er und skizziert humorvoll bis phantastisch, sprachgewaltig und poetisch das Treiben in einer süddeutschen Stadt, erzählt von amerikanischer Kasernen und Gaststätten und zieht den Leser nahezu spielend in seinen Bann, wenn der Roman sich zwischenzeitlich immer wieder an charmanten Sprachbildern ergötzt. Beispiel gefällig? „Durchsetzt von den Rückständen dieses Widerwillens schwebte der Auspuffdunst als eine quecksilbrige Schwade in der klaren kühlen Luft.“ Wem das ein bisschen zu abstrakt ist, der kann sich aber auch einfach an der gelungenen Kindergruselgeschichte erfreuen, die Klein hier in bester Lynch-Manier aus dem Ärmel schüttelt. In gewisser Weise dreht sich der Roman vor allem um die Angst und die Neugier junger Menschen und alles, was in deren Grenzgebiet so geschieht. Die Protagonisten – die „schicke Sybille“, der „Ami-Michi“ oder der „Schniefer“ – durchleben den ganz normalen Wahnsinn der Sommerferien und man genießt dieses Buch, das deutlich macht, welch seltsame Momente das Leben doch für jeden von uns bereit hält. Alles in allem: ein fantastisch mitreißendes Buch.
 Leif Randt begibt sich in seinem neuen Roman „Leuchtspielhaus“ derweil auf die Suche nach einem besseren Leben. Der Protagonist seines mit zahlreichen Dialogen durchzogenen Werks durchstreift Osteropa, London und die Schweiz auf der Suche nach einer verschollenen Künstlerin, die er für eine Rakete hält, die nur noch abgefeuert gehört, um dann alle (vor allem ihn selbst) mit ihrem Antlitz am nächtlichen Himmelszelt zu erfreuen. Von seinem Roman ist man entweder nach fünfzig Seiten restlos begeistert oder legt ihn entnervt zur Seite. Rastlos, bisweilen nach Sauerstoff lechzend, nimmt er den Leser bei der Hand und berauscht ihn dabei in einer ähnlichen Weise, wie zuletzt Helene Hegemann, vergisst allerdings auch nicht, immer wieder das Bühnenbild auszuleuchten und die Gesamtsituation im Blick zu behalten. Alles in allem ist „Leuchtspielhaus“ vor allem eine Liebesgeschichte. Eine, in welcher der Protagonist rastlos nach einem Zustand der Zufriedenheit fahndet.
Leif Randt begibt sich in seinem neuen Roman „Leuchtspielhaus“ derweil auf die Suche nach einem besseren Leben. Der Protagonist seines mit zahlreichen Dialogen durchzogenen Werks durchstreift Osteropa, London und die Schweiz auf der Suche nach einer verschollenen Künstlerin, die er für eine Rakete hält, die nur noch abgefeuert gehört, um dann alle (vor allem ihn selbst) mit ihrem Antlitz am nächtlichen Himmelszelt zu erfreuen. Von seinem Roman ist man entweder nach fünfzig Seiten restlos begeistert oder legt ihn entnervt zur Seite. Rastlos, bisweilen nach Sauerstoff lechzend, nimmt er den Leser bei der Hand und berauscht ihn dabei in einer ähnlichen Weise, wie zuletzt Helene Hegemann, vergisst allerdings auch nicht, immer wieder das Bühnenbild auszuleuchten und die Gesamtsituation im Blick zu behalten. Alles in allem ist „Leuchtspielhaus“ vor allem eine Liebesgeschichte. Eine, in welcher der Protagonist rastlos nach einem Zustand der Zufriedenheit fahndet.
 Die Drive By Truckers fristen hierzulande derweil immer noch ein Dasein abseits des Mainstreams. Dabei hätte die Band es schon längst verdient endlich an die Oberfläche der Rockcharts zu klettern und ihren nostalgisch anmutenden Alternative-Rock in die Herzkammern der Soul Asylum bis Hold Steady-Fraktion zu pressen. „The Big To-Do“ klingt im Endeffekt wie die Alben zuvor: Nach Dreck. Nach Schmutz. Geerdet und bodenständig. Mitsingträchtig, wie Springsteen-Songs, schlängeln sich die Melodien ihren Weg aus dem Soundsystem und sorgen dafür, dass man spätestens beim dritten Song Freude strahlend die Arme in die Luft reißt. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sich die Mitglieder auf ein Stelldichein am abendlichen Flussufer verabredet und geschaut, was da für Songs dabei raus springen, während der Blick ergriffen in Richtung der roten Sonne streift. Wer auf die Lemonheads und The Gaslight Anthem steht, sollte diese Band unbedingt mal anchecken und dann sofort den Backkatalog nachordern. Lohnt sich schon allein wegen den doppelbödigen Songtexte.
Die Drive By Truckers fristen hierzulande derweil immer noch ein Dasein abseits des Mainstreams. Dabei hätte die Band es schon längst verdient endlich an die Oberfläche der Rockcharts zu klettern und ihren nostalgisch anmutenden Alternative-Rock in die Herzkammern der Soul Asylum bis Hold Steady-Fraktion zu pressen. „The Big To-Do“ klingt im Endeffekt wie die Alben zuvor: Nach Dreck. Nach Schmutz. Geerdet und bodenständig. Mitsingträchtig, wie Springsteen-Songs, schlängeln sich die Melodien ihren Weg aus dem Soundsystem und sorgen dafür, dass man spätestens beim dritten Song Freude strahlend die Arme in die Luft reißt. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sich die Mitglieder auf ein Stelldichein am abendlichen Flussufer verabredet und geschaut, was da für Songs dabei raus springen, während der Blick ergriffen in Richtung der roten Sonne streift. Wer auf die Lemonheads und The Gaslight Anthem steht, sollte diese Band unbedingt mal anchecken und dann sofort den Backkatalog nachordern. Lohnt sich schon allein wegen den doppelbödigen Songtexte.
 Emanuel And The Fear bitten derweil um Aufmerksamkeit für „Listen“, das neue Album der New Yorker Orchester-Truppe müht sich daran ab, Bright Eyes, Daft Punk und Arcade Fire auf einem Silberling zu vereinen. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Mache Songs wirken durch den elektronischen Überbau bisweilen etwas überproduziert. Trotzdem schlummert immer wieder ein schmissiger Hit zwischen den Songs, was ja bei 19 Tracks auch kein großes Wunder ist. Alles in allem ein ambitioniertes Werk, dem etwas weniger Produktion und Straffung gut zu Gesicht gestanden hätte, das aber für Indie-Rock-Pfadfinder sehr viel bereit hält, was es zu entdecken gäbe. Vorausgesetzt natürlich man nimmt sich die Zeit dafür.
Emanuel And The Fear bitten derweil um Aufmerksamkeit für „Listen“, das neue Album der New Yorker Orchester-Truppe müht sich daran ab, Bright Eyes, Daft Punk und Arcade Fire auf einem Silberling zu vereinen. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Mache Songs wirken durch den elektronischen Überbau bisweilen etwas überproduziert. Trotzdem schlummert immer wieder ein schmissiger Hit zwischen den Songs, was ja bei 19 Tracks auch kein großes Wunder ist. Alles in allem ein ambitioniertes Werk, dem etwas weniger Produktion und Straffung gut zu Gesicht gestanden hätte, das aber für Indie-Rock-Pfadfinder sehr viel bereit hält, was es zu entdecken gäbe. Vorausgesetzt natürlich man nimmt sich die Zeit dafür.
 Der nimmermüde Schreiberling Denis Johnson begibt sich in seinem neuen Werk „Keine Bewegung!“ in Coen-istische Gefilde und liefert ein Buch ab, das vor absurden Situationen nur so trieft. Im Thriller-Genre angesiedelt, wandelt er durch eine Pop-Art-Welt der Post-Pulp Fiction-Ära und lässt so viel Blut fließen, als wollte er links blinken, um Tarantino in Sachen Gewalt zu überholen. Ähnlich wie John Niven wohnt dem Buch ein skuriller Humor inne, der einen entweder fesselt, oder schon nach wenigen Seiten den letzten Nerv kostet. Eigentlich für den amerikanischen „Playboy“ konzipiert, ist „Keine Bewegung!“ sicher kein literarisches Meisterstück, aber für Menschen mit schwarzem Humor ein ungemein mitreißender Zeitvertreib.
Der nimmermüde Schreiberling Denis Johnson begibt sich in seinem neuen Werk „Keine Bewegung!“ in Coen-istische Gefilde und liefert ein Buch ab, das vor absurden Situationen nur so trieft. Im Thriller-Genre angesiedelt, wandelt er durch eine Pop-Art-Welt der Post-Pulp Fiction-Ära und lässt so viel Blut fließen, als wollte er links blinken, um Tarantino in Sachen Gewalt zu überholen. Ähnlich wie John Niven wohnt dem Buch ein skuriller Humor inne, der einen entweder fesselt, oder schon nach wenigen Seiten den letzten Nerv kostet. Eigentlich für den amerikanischen „Playboy“ konzipiert, ist „Keine Bewegung!“ sicher kein literarisches Meisterstück, aber für Menschen mit schwarzem Humor ein ungemein mitreißender Zeitvertreib.
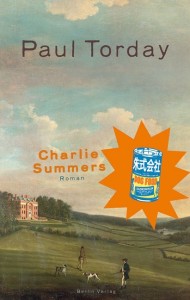 Paul Torday wagt sich derweil daran, einen Blick auf unser hysterisches Zeitalter im Sturm der Wirtschaftskrise zu werfen. Sein Roman „Charlie Summers“ erzählt die Geschichte dreier Lebenskünstler, motzt das Ganze aber mit dermaßen viel Spott und Ironie über unser irdisches Dasein im Zeichen des Kapitals auf, dass man sich nur zu gerne in den Zeilen des Romans verliert. Hector Chetwode-Talbots redet sich dabei als findiger Lebenskünstler um Kopf und Kragen und trifft schließlich Bilbo. Eine menschliche Geld-Druck-Maschine ohne Skrupel. „Regel Nr.1: Wir wollen Geld verdienen, Regel Nr. 2: Wir wollen Geld verdienen, Regel Nr. 3: Wenn wir mal kein Geld verdienen wollen, treten automatisch Regel Nr. 1 und 2 in Kraft“. Zusammen treffen sie sich auf ein wohl schmeckendes Dinner mit einem gewissen Charlie Summers. Und danach ist dann nichts mehr wie zuvor… „Charlies Summers“ ist eine gekonnte, gesellschaftliche Analyse, die einem ohne fachliches Geschwafel vermittelt, warum unserer Gesellschaft finanziell im Abgrund gelandet ist. Was für ein Dilemma, denn „Leider nur war es keine wirkliche Ruhe, es war eine Betäubung – eine Betäubung der Sinne“. Finanzhaie und Bankräuber. Unbedingt lesen, bitte!
Paul Torday wagt sich derweil daran, einen Blick auf unser hysterisches Zeitalter im Sturm der Wirtschaftskrise zu werfen. Sein Roman „Charlie Summers“ erzählt die Geschichte dreier Lebenskünstler, motzt das Ganze aber mit dermaßen viel Spott und Ironie über unser irdisches Dasein im Zeichen des Kapitals auf, dass man sich nur zu gerne in den Zeilen des Romans verliert. Hector Chetwode-Talbots redet sich dabei als findiger Lebenskünstler um Kopf und Kragen und trifft schließlich Bilbo. Eine menschliche Geld-Druck-Maschine ohne Skrupel. „Regel Nr.1: Wir wollen Geld verdienen, Regel Nr. 2: Wir wollen Geld verdienen, Regel Nr. 3: Wenn wir mal kein Geld verdienen wollen, treten automatisch Regel Nr. 1 und 2 in Kraft“. Zusammen treffen sie sich auf ein wohl schmeckendes Dinner mit einem gewissen Charlie Summers. Und danach ist dann nichts mehr wie zuvor… „Charlies Summers“ ist eine gekonnte, gesellschaftliche Analyse, die einem ohne fachliches Geschwafel vermittelt, warum unserer Gesellschaft finanziell im Abgrund gelandet ist. Was für ein Dilemma, denn „Leider nur war es keine wirkliche Ruhe, es war eine Betäubung – eine Betäubung der Sinne“. Finanzhaie und Bankräuber. Unbedingt lesen, bitte!
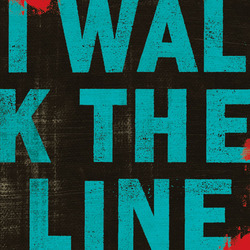 Und zum Abschluss dann noch mal die neue Scheibe von I Walk The Line ausgecheckt. Die haben mit „Language Of The Lost“ in diesen Tagen endlich ihr neues New Wave-Brett mit vorne dran geschraubten Gitarren-Flammenwerfern am Start. Wer die Jungs noch nicht kennt, kann sich den Sound ungefähr folgendermaßen ausmalen: man stelle sich einen alten The Clash-Song vor, der von Smoke Blow durch den Reißwolf gedreht wird. Daraus entspringen dann Hymnen, die einem Beatsteaks-Hit in nichts nachstehen und auf jedem gut durchrockten Festivalgelände für die entsprechende Untermalung des bierseligen Gegröles herhalten können. Dabei schadet es auch nicht, dass gleich im Opener ein wenig bei The Church abgebauscht wird. Das sorgt sogar dafür, dass die Wölfe nur noch lauter in Richtung Mondschein jaulen. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Und zum Abschluss dann noch mal die neue Scheibe von I Walk The Line ausgecheckt. Die haben mit „Language Of The Lost“ in diesen Tagen endlich ihr neues New Wave-Brett mit vorne dran geschraubten Gitarren-Flammenwerfern am Start. Wer die Jungs noch nicht kennt, kann sich den Sound ungefähr folgendermaßen ausmalen: man stelle sich einen alten The Clash-Song vor, der von Smoke Blow durch den Reißwolf gedreht wird. Daraus entspringen dann Hymnen, die einem Beatsteaks-Hit in nichts nachstehen und auf jedem gut durchrockten Festivalgelände für die entsprechende Untermalung des bierseligen Gegröles herhalten können. Dabei schadet es auch nicht, dass gleich im Opener ein wenig bei The Church abgebauscht wird. Das sorgt sogar dafür, dass die Wölfe nur noch lauter in Richtung Mondschein jaulen. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?