 Alle, die mal wieder eine musikalische Zeitreise machen möchten, sollten jetzt die Ohren spitzen. Superchunk, die ollen Indierock-Haudegen, sind wieder da und präsentieren sich auf ihrem aktuellen Werk in der Form ihres Lebens. Schon nach wenigen Sekunden reißt einen der Opener „Digging For Something“ zurück in die 90er und schlitzt einem die Jeans auf. Hinterher wird dann mit wunden Knien der Bühnenboden abgeknutscht, bevor man sich beim Stage-Diven in die ausgestreckten Hände der schweißüberströmten Menge plumpsen lässt.
Alle, die mal wieder eine musikalische Zeitreise machen möchten, sollten jetzt die Ohren spitzen. Superchunk, die ollen Indierock-Haudegen, sind wieder da und präsentieren sich auf ihrem aktuellen Werk in der Form ihres Lebens. Schon nach wenigen Sekunden reißt einen der Opener „Digging For Something“ zurück in die 90er und schlitzt einem die Jeans auf. Hinterher wird dann mit wunden Knien der Bühnenboden abgeknutscht, bevor man sich beim Stage-Diven in die ausgestreckten Hände der schweißüberströmten Menge plumpsen lässt.
„Majesty Shredding“ klingt so schrecklich-schön rotzig, wie seit dem Comeback-Album von Dinosaur Jr .nichts mehr. Es scheint fast so, als wäre das Uhrwerk der Jungs seit neun Jahren auf „stand by“ geschaltet gewesen. „Majesty Shredding“ macht in diesem Zusammenhang klar, dass es an der Zeit war, wieder die Starttaste zu betätigen. Und demnächst werden sie dann wieder alle mitgrölen: „You Were Digging For Something, Oh.. oh.. oh!” Verdammt noch mal, was für ein Hitreigen!
 Garrett Klahn von Texas Is The Reason und John Herguth von House & Parish machen sich als Superhelden-Duo Atlantic/Pacific derweil daran, die Welt in Wohlfühlmodus zu überführen. „Meet Your New Love“ haben sie zusammen mit Ian Love von den Rival Schools eingespielt, die uns demnächst auch höchstpersönlich mit einem neuen Werk beglücken möchten (der kürzliche Walter Schreifels Auftritt mit Olli Schulz im Jugendkulturhaus Cairo hat da ja schon mal für ordentlich Vorfreude gesorgt). Auf der Scheibe regiert derweil die Melancholie, schwelgerische Klänge fluten den Raum und sorgen dafür, dass man als Hörer die Augen schließt und sich von diesen bisweilen cineastischen Gebilden an ferne Orte schleifen lässt. Dazu gesellt sich ein Hauch von Smiths-Melodramatik und Lagerfeuer-Zerhackstückelung der Marke Fleet Foxes. Man muss nicht unbedingt auf traditionelle Melodien stehen, um dieses Werk ins Herz zu schließen. Folge einfach deinem Gefühl und „meet your new love“ am Atlantik, am Pazifik, ach, wo auch immer…
Garrett Klahn von Texas Is The Reason und John Herguth von House & Parish machen sich als Superhelden-Duo Atlantic/Pacific derweil daran, die Welt in Wohlfühlmodus zu überführen. „Meet Your New Love“ haben sie zusammen mit Ian Love von den Rival Schools eingespielt, die uns demnächst auch höchstpersönlich mit einem neuen Werk beglücken möchten (der kürzliche Walter Schreifels Auftritt mit Olli Schulz im Jugendkulturhaus Cairo hat da ja schon mal für ordentlich Vorfreude gesorgt). Auf der Scheibe regiert derweil die Melancholie, schwelgerische Klänge fluten den Raum und sorgen dafür, dass man als Hörer die Augen schließt und sich von diesen bisweilen cineastischen Gebilden an ferne Orte schleifen lässt. Dazu gesellt sich ein Hauch von Smiths-Melodramatik und Lagerfeuer-Zerhackstückelung der Marke Fleet Foxes. Man muss nicht unbedingt auf traditionelle Melodien stehen, um dieses Werk ins Herz zu schließen. Folge einfach deinem Gefühl und „meet your new love“ am Atlantik, am Pazifik, ach, wo auch immer…
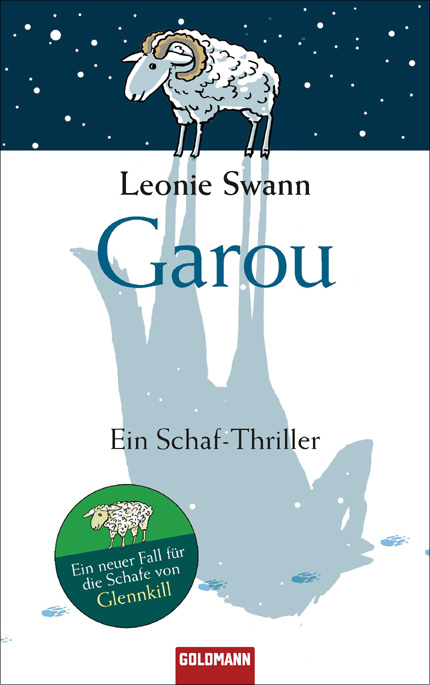 Wer derweil noch einen lustigen Schmöker für den Herbst sucht, der braucht sich in Sachen sympathischster Story nicht lange umzugucken. Leonie Swann lies ja schon in „Glennkill“ eine Horde Schafe einen Kriminalfall lösen und erntete dafür einen einzigen Schwall an Liebesbekundungen. Nun legt sie folgerichtig den Nachfolger vor und „Garou“ macht genau dort weiter, wo der Erstling aufgehört hat. Diesmal treibt die neue Schäferin Rebecca (die Tochter des Schäfers, dessen Mordfall im ersten Roman aufgerollt wird) ihre kleinen Wollknäuel-Detektive in ein französisches Schloss, wo sie in aller Seelenruhe überwintern möchten. Natürlich klappt das nicht so ganz, weil plötzlich ein paar Rehe in die ewigen Jagdgründe eingehen. Als dann auch noch ein Toter unter der alten Eiche vor sich hin vegetiert, wissen die Schäfchen, da ist auf jeden Fall (oder Fell?!) was faul. Also machen sich Miss Mapel und Moppel mit ihren plüschigen Mitstreitern daran, ihre voluminösen Spürnasen nach Verdächtigen auszustrecken. Darauf wechseln sich spooky Szenen mit gewitzten Dialogen ab, wodurch die Geschichte niemals langweilig wird. Noch dazu haben die Schafe in der Figur Garou – einem Werwolf (oder doch nicht?) – einen gleichwertigen Gegner, der sich nicht so gern in die Karten schauen lässt. Alles in allem muss man nicht unbedingt ein Faible für Tiergeschichten mitbringen, um sich vollends in der Geschichte der Münchner Autorin zu verlieren. Die studierte Psychologin und Philosophin wirft nämlich immer wieder ihr Expertenwissen in die Waagschale und erzählt neben einem Krimi auch die Geschichte von uns Menschen. Bemerkenswert daran ist, dass sie dies aus der Sicht der Tiere tut, die uns – wen wundert es – über weite Strecken nicht unbedingt wohl gesonnen gegenüber stehen. Eben deshalb ist „Garou“ auch eine Parabel auf das Leben. Es geht ums Fressen und Gefressen werden. Und man muss hin und wieder ganz tief einatmen, wenn Swann einem die knallharten Fakten auf dem Silbertablett serviert, wie Köstlichkeiten aus der Metzgerei.
Wer derweil noch einen lustigen Schmöker für den Herbst sucht, der braucht sich in Sachen sympathischster Story nicht lange umzugucken. Leonie Swann lies ja schon in „Glennkill“ eine Horde Schafe einen Kriminalfall lösen und erntete dafür einen einzigen Schwall an Liebesbekundungen. Nun legt sie folgerichtig den Nachfolger vor und „Garou“ macht genau dort weiter, wo der Erstling aufgehört hat. Diesmal treibt die neue Schäferin Rebecca (die Tochter des Schäfers, dessen Mordfall im ersten Roman aufgerollt wird) ihre kleinen Wollknäuel-Detektive in ein französisches Schloss, wo sie in aller Seelenruhe überwintern möchten. Natürlich klappt das nicht so ganz, weil plötzlich ein paar Rehe in die ewigen Jagdgründe eingehen. Als dann auch noch ein Toter unter der alten Eiche vor sich hin vegetiert, wissen die Schäfchen, da ist auf jeden Fall (oder Fell?!) was faul. Also machen sich Miss Mapel und Moppel mit ihren plüschigen Mitstreitern daran, ihre voluminösen Spürnasen nach Verdächtigen auszustrecken. Darauf wechseln sich spooky Szenen mit gewitzten Dialogen ab, wodurch die Geschichte niemals langweilig wird. Noch dazu haben die Schafe in der Figur Garou – einem Werwolf (oder doch nicht?) – einen gleichwertigen Gegner, der sich nicht so gern in die Karten schauen lässt. Alles in allem muss man nicht unbedingt ein Faible für Tiergeschichten mitbringen, um sich vollends in der Geschichte der Münchner Autorin zu verlieren. Die studierte Psychologin und Philosophin wirft nämlich immer wieder ihr Expertenwissen in die Waagschale und erzählt neben einem Krimi auch die Geschichte von uns Menschen. Bemerkenswert daran ist, dass sie dies aus der Sicht der Tiere tut, die uns – wen wundert es – über weite Strecken nicht unbedingt wohl gesonnen gegenüber stehen. Eben deshalb ist „Garou“ auch eine Parabel auf das Leben. Es geht ums Fressen und Gefressen werden. Und man muss hin und wieder ganz tief einatmen, wenn Swann einem die knallharten Fakten auf dem Silbertablett serviert, wie Köstlichkeiten aus der Metzgerei.
 Die wunderbaren Indie-Rocker von No Age haben in der Zwischenzeit auch ein neues Album eingespielt und verkleben uns damit ganz unverschämt die Gehörgänge. Fängt alles ziemlich harmlos an, was da auf einen zuströmt, doch wenn dann die letzten Töne des psychedelischen Openers verklungen sind, wird einfach mal voll auf die Tube gedrückt. Der Pop-Appeal von „Everything In Between“ überrascht nicht nur auf den ersten Blick. Manchmal meint man, es würden unveröffentlichte Songs von The Cure in einer verstrahlten Pains Of Being Pure At Heart-Version aus den Boxen strömen. Klingt alles seltsam vertraut, was die Jungs hier aus dem Ärmel schütteln, aber man kommt einfach nicht dahinter, wo man die einzelnen Melodie-Bögen schon mal gehört hat. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Masche der Band, Songs zu schreiben, die sich schon beim zweiten Durchlauf wie alte Bekannte anfühlen. Dazu rummst es auf „Everything In Between“ aber auch ganz ordentlich. Alles in allem der vielleicht schönste Eye-Catcher des Herbstes für alle, die bei vielen aktuellen Indie-Pop-Acts vor lauter Pop den Indie-Aspekt vermissen.
Die wunderbaren Indie-Rocker von No Age haben in der Zwischenzeit auch ein neues Album eingespielt und verkleben uns damit ganz unverschämt die Gehörgänge. Fängt alles ziemlich harmlos an, was da auf einen zuströmt, doch wenn dann die letzten Töne des psychedelischen Openers verklungen sind, wird einfach mal voll auf die Tube gedrückt. Der Pop-Appeal von „Everything In Between“ überrascht nicht nur auf den ersten Blick. Manchmal meint man, es würden unveröffentlichte Songs von The Cure in einer verstrahlten Pains Of Being Pure At Heart-Version aus den Boxen strömen. Klingt alles seltsam vertraut, was die Jungs hier aus dem Ärmel schütteln, aber man kommt einfach nicht dahinter, wo man die einzelnen Melodie-Bögen schon mal gehört hat. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Masche der Band, Songs zu schreiben, die sich schon beim zweiten Durchlauf wie alte Bekannte anfühlen. Dazu rummst es auf „Everything In Between“ aber auch ganz ordentlich. Alles in allem der vielleicht schönste Eye-Catcher des Herbstes für alle, die bei vielen aktuellen Indie-Pop-Acts vor lauter Pop den Indie-Aspekt vermissen.
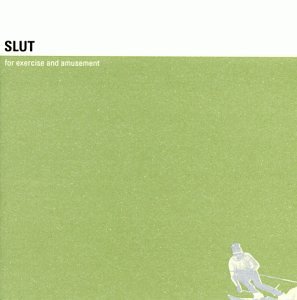 Das illustre Label „Stickman Records“ hat sich derweil dazu entschlossen, die frühen Werke von Slut nochmal aus der Kiste zu kramen und sie in den örtlichen Plattenläden zu platzieren. Wer die Jungs vor dem großen Durchbruch noch nicht auf den Schirm hatte, sollte die Chance nutzen und sich „For Exercise And Amusement“ und „Interference“ unbedingt nach Hause holen. Die Scheiben stehen den restlichen Releases der Band in Nichts nach. Ein psychedelischer Schleier liegt über der Musik und ein Hit, wie „Interference“ macht klar, wozu diese Band fortan noch im Stande sein wird.
Das illustre Label „Stickman Records“ hat sich derweil dazu entschlossen, die frühen Werke von Slut nochmal aus der Kiste zu kramen und sie in den örtlichen Plattenläden zu platzieren. Wer die Jungs vor dem großen Durchbruch noch nicht auf den Schirm hatte, sollte die Chance nutzen und sich „For Exercise And Amusement“ und „Interference“ unbedingt nach Hause holen. Die Scheiben stehen den restlichen Releases der Band in Nichts nach. Ein psychedelischer Schleier liegt über der Musik und ein Hit, wie „Interference“ macht klar, wozu diese Band fortan noch im Stande sein wird. 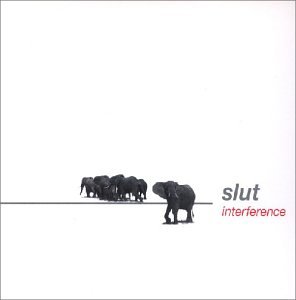 Hinter all dem Lärm und den Gitarren wird immer wieder der Wunsch sichtbar, hymnische Pop-Songs zu schreiben. Eben deshalb möchte man zu einem Stück wie „Postcard No. 17“ am liebsten die/den verdutzte/Studienkollegin/en vom Stuhl knutschen. Slut schreiben Hymnen, die einen stundenlang nicht mehr loslassen. Die man den lieben langen Tag unaufhörlich vor sich her summt. Schön, dass Slut sich auch auf ihrer kommenden Tour wieder den verschollenen Perlen hier annehmen werden. Alles in allem ein außerordentlich schmissiges Frühwerk, dessen trockene Songs gerade aufgrund des vollständigen Verzichts auf elektronische Anleihen, direkt ins Herz des Hörers rasen.
Hinter all dem Lärm und den Gitarren wird immer wieder der Wunsch sichtbar, hymnische Pop-Songs zu schreiben. Eben deshalb möchte man zu einem Stück wie „Postcard No. 17“ am liebsten die/den verdutzte/Studienkollegin/en vom Stuhl knutschen. Slut schreiben Hymnen, die einen stundenlang nicht mehr loslassen. Die man den lieben langen Tag unaufhörlich vor sich her summt. Schön, dass Slut sich auch auf ihrer kommenden Tour wieder den verschollenen Perlen hier annehmen werden. Alles in allem ein außerordentlich schmissiges Frühwerk, dessen trockene Songs gerade aufgrund des vollständigen Verzichts auf elektronische Anleihen, direkt ins Herz des Hörers rasen.
 The Unlimiters packen derweil die Nostalgie-Keule aus und hauen uns 15 zurückgelehnte Perlen im Grenzgebeit von Posaunen und Trompeten um die Ohren. Ska trifft auf diesem wirklich gelungenen Werk der 7 bis 10-köpfigen Combo auf Surf-Anleihen und Pop-Melodien. Wer auf The Specials und Konsorten steht, sollte sich die Scheibe auf keinen Fall entgehen lassen. So viele Gründe, sich in die Hängematte zu schmeißen, findet man sonst nicht mal auf der nächsten Palmenstrand-Oase. Wer sich in diesem Tagen nach einem echten Sommeralbum sehnt, sollte sich dieses zweistimmig eingesäuselte Werk der Protagonisten Nathan Moore und Erika Abalos unbedingt ins Regal stellen.
The Unlimiters packen derweil die Nostalgie-Keule aus und hauen uns 15 zurückgelehnte Perlen im Grenzgebeit von Posaunen und Trompeten um die Ohren. Ska trifft auf diesem wirklich gelungenen Werk der 7 bis 10-köpfigen Combo auf Surf-Anleihen und Pop-Melodien. Wer auf The Specials und Konsorten steht, sollte sich die Scheibe auf keinen Fall entgehen lassen. So viele Gründe, sich in die Hängematte zu schmeißen, findet man sonst nicht mal auf der nächsten Palmenstrand-Oase. Wer sich in diesem Tagen nach einem echten Sommeralbum sehnt, sollte sich dieses zweistimmig eingesäuselte Werk der Protagonisten Nathan Moore und Erika Abalos unbedingt ins Regal stellen.
 Emo Pop der hymnischen Sorte fabrizieren zum Abschluss die Konsens-Rocker von Hawthorne Heights. Die springen passend zu Halloween aus der Gruft, um uns mit ihren Kayal-Hymnen die Gehörgänge voll zu pinseln. Bemerkenswert ist vor allem, dass man „Skeletons“ gar nicht so richtig doof finden kann, weil Songs, wie „Bring You Back“ oder „Broken Man“ genau die Melodien in der Hinterhand haben, die man den lieben langen Tag unaufhörlich vor sich hersummt. Soll heiße: der Kitsch-Faktor ist zwar extrem hoch, die Hitdichte aber auch. Gerade zu Halloween ist man zudem ja gerne mal Fan des schlechten Geschmacks. In dieser Hinsicht eignet sich „Skeletons“ ganz vortrefflich, um die örtliche Geisterparty mal ein wenig aufzupeppeln. Alles in allem: Besser als erwartet. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Emo Pop der hymnischen Sorte fabrizieren zum Abschluss die Konsens-Rocker von Hawthorne Heights. Die springen passend zu Halloween aus der Gruft, um uns mit ihren Kayal-Hymnen die Gehörgänge voll zu pinseln. Bemerkenswert ist vor allem, dass man „Skeletons“ gar nicht so richtig doof finden kann, weil Songs, wie „Bring You Back“ oder „Broken Man“ genau die Melodien in der Hinterhand haben, die man den lieben langen Tag unaufhörlich vor sich hersummt. Soll heiße: der Kitsch-Faktor ist zwar extrem hoch, die Hitdichte aber auch. Gerade zu Halloween ist man zudem ja gerne mal Fan des schlechten Geschmacks. In dieser Hinsicht eignet sich „Skeletons“ ganz vortrefflich, um die örtliche Geisterparty mal ein wenig aufzupeppeln. Alles in allem: Besser als erwartet. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?