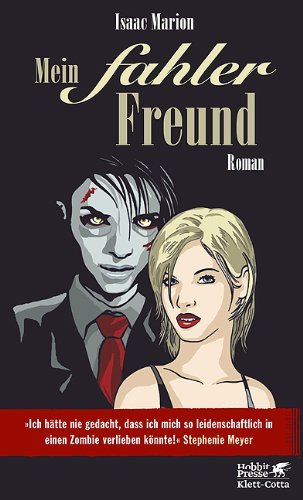 Kann das gut gehen? Eine Zombie-Liebesgeschichte? Es kann… Jedenfalls dann, wenn Isaac Marion zum Schreibblock greift und all das, was an Zombies so furcht-erregend ist, mit einer gehörigen Portion Ironie kontert. Schon allein wie dieser Text hier los legt… ein Genuss: „Ich bin tot, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe gelernt, damit zu leben…“ Treffender kann man das Gefühl zum Untoten zu mutieren wohl nicht in Worte fassen. „Mein fahler Freund“ strotzt nur so vor solchen Passagen. Der Roman ist mit einer Lässigkeit und „Bissigkeit“ getextet, dass man schon nach wenigen Seiten an seinen Lippen klebt. Spätestens aber, wenn sich unser Zombie „R“ (der so heißt, weil er sich nach seinem Ableben nur noch an den Anfangsbuchstaben seines Namens erinnern kann) bei der Nahrungssuche auf Julie trifft, deren Freund er mal eben beiseite geschafft hat, indem er ihm das Hirn raus geschlürft hat, spätestens dann ist man ergriffen von dieser Zombie-Dramödie, die so viel Charme ausstrahlt, dass all die Vampirromane der Gegenwart ziemlich fahl dagegen aussehen. Der Clou an diesem Buch ist: Als „R“ Julies Freund verspeist, hat er sich versehentlich auch die Gefühle für dessen Herzallerliebste einverleibt, also muss sie fortan vor dem Rest der mordenden Horde beschützt werden. Deshalb versucht er sie ins Stadion der Stadt zu schaffen, wo die letzten Überlebenden der Epidemie von besseren Zeiten träumen. Immer mehr verschwimmen die Grenzen zwischen dem, was „R“s Trieb im rät und seinem Herzklopfen in Bezug auf Julie. Ganz nebenbei stellt der Autor in seinem Roman auch die Existenzfrage, was diesem Horror-Schinken noch dazu eine anspruchsvolle Note verleiht. Wer also auf gehobene Literatur mit einem Faible für Absurditäten steht, der sollte unbedingt mal reinschnuppern. Es lohnt sich.
Kann das gut gehen? Eine Zombie-Liebesgeschichte? Es kann… Jedenfalls dann, wenn Isaac Marion zum Schreibblock greift und all das, was an Zombies so furcht-erregend ist, mit einer gehörigen Portion Ironie kontert. Schon allein wie dieser Text hier los legt… ein Genuss: „Ich bin tot, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe gelernt, damit zu leben…“ Treffender kann man das Gefühl zum Untoten zu mutieren wohl nicht in Worte fassen. „Mein fahler Freund“ strotzt nur so vor solchen Passagen. Der Roman ist mit einer Lässigkeit und „Bissigkeit“ getextet, dass man schon nach wenigen Seiten an seinen Lippen klebt. Spätestens aber, wenn sich unser Zombie „R“ (der so heißt, weil er sich nach seinem Ableben nur noch an den Anfangsbuchstaben seines Namens erinnern kann) bei der Nahrungssuche auf Julie trifft, deren Freund er mal eben beiseite geschafft hat, indem er ihm das Hirn raus geschlürft hat, spätestens dann ist man ergriffen von dieser Zombie-Dramödie, die so viel Charme ausstrahlt, dass all die Vampirromane der Gegenwart ziemlich fahl dagegen aussehen. Der Clou an diesem Buch ist: Als „R“ Julies Freund verspeist, hat er sich versehentlich auch die Gefühle für dessen Herzallerliebste einverleibt, also muss sie fortan vor dem Rest der mordenden Horde beschützt werden. Deshalb versucht er sie ins Stadion der Stadt zu schaffen, wo die letzten Überlebenden der Epidemie von besseren Zeiten träumen. Immer mehr verschwimmen die Grenzen zwischen dem, was „R“s Trieb im rät und seinem Herzklopfen in Bezug auf Julie. Ganz nebenbei stellt der Autor in seinem Roman auch die Existenzfrage, was diesem Horror-Schinken noch dazu eine anspruchsvolle Note verleiht. Wer also auf gehobene Literatur mit einem Faible für Absurditäten steht, der sollte unbedingt mal reinschnuppern. Es lohnt sich.
 „Zehn Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen“ hat nicht nur das Zeug zum Buchtitel des Jahres, es ist auch ein amüsanter Rundumschlag in Sachen Identitätsfindung. Die Story ist auf den ersten Blick genauso absurd, wie der Buchtitel: ein Auftragskiller soll nach 66 Tötungsdelikten verhaftet werden (leider Gottes war der 66te ein FBI-Agent), also begeht er einen Mord, um in die Identität eines Anderen zu schlüpfen. Blöd nur, dass es sich dabei ausgerechnet um einen Fernsehprediger handelt, der auf dem Weg nach Island ist. Dort ist es nicht nur eiskalt, Protagonist Toxic muss sich als Reinkarnation von „Father Friendly“ auch mit zahlreichen Anwohnern auseinander setzen, die komischerweise allesamt seine Nähe suchen oder ihn erstmal rigoros ablehnen. Hallgrímur Helgason erschafft mit „Zehn Tipps…“ einen Gesellschaftsroman, der einerseits nur so strotzt vor pechschwarzem Humor, was immer wieder für Lachkrämpfe beim Leser sorgt, wenn er zum Beispiel darüber nachdenkt, ein Bestattungsunternehmen zu kaufen, um an seinen Morden noch mal zusätzlich zu verdienen. Überhaupt ist die knochentrockene, pragmatische Art, mit der der Killer hier vorgeht ein gefundenes Fressen für alle, die sich auch gerne die TV-Serie „Dexter“ zu Gemüte führen. Da verzeiht man gegen Ende auch, dass die Story mit zunehmender Dauer immer abstruser und unglaubwürdiger anmutet. „Zehn Tipps…“ ist vor allem ein schreiend komisches, immer überhebliches, bisweilen vorurteilsbehaftetes, ziemlich kompromissloses Werk. Da bleibt dem Leser nur eins, hemmungslos loslachen oder empört abwinken. Ich entscheide mich für Ersteres.
„Zehn Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen“ hat nicht nur das Zeug zum Buchtitel des Jahres, es ist auch ein amüsanter Rundumschlag in Sachen Identitätsfindung. Die Story ist auf den ersten Blick genauso absurd, wie der Buchtitel: ein Auftragskiller soll nach 66 Tötungsdelikten verhaftet werden (leider Gottes war der 66te ein FBI-Agent), also begeht er einen Mord, um in die Identität eines Anderen zu schlüpfen. Blöd nur, dass es sich dabei ausgerechnet um einen Fernsehprediger handelt, der auf dem Weg nach Island ist. Dort ist es nicht nur eiskalt, Protagonist Toxic muss sich als Reinkarnation von „Father Friendly“ auch mit zahlreichen Anwohnern auseinander setzen, die komischerweise allesamt seine Nähe suchen oder ihn erstmal rigoros ablehnen. Hallgrímur Helgason erschafft mit „Zehn Tipps…“ einen Gesellschaftsroman, der einerseits nur so strotzt vor pechschwarzem Humor, was immer wieder für Lachkrämpfe beim Leser sorgt, wenn er zum Beispiel darüber nachdenkt, ein Bestattungsunternehmen zu kaufen, um an seinen Morden noch mal zusätzlich zu verdienen. Überhaupt ist die knochentrockene, pragmatische Art, mit der der Killer hier vorgeht ein gefundenes Fressen für alle, die sich auch gerne die TV-Serie „Dexter“ zu Gemüte führen. Da verzeiht man gegen Ende auch, dass die Story mit zunehmender Dauer immer abstruser und unglaubwürdiger anmutet. „Zehn Tipps…“ ist vor allem ein schreiend komisches, immer überhebliches, bisweilen vorurteilsbehaftetes, ziemlich kompromissloses Werk. Da bleibt dem Leser nur eins, hemmungslos loslachen oder empört abwinken. Ich entscheide mich für Ersteres.
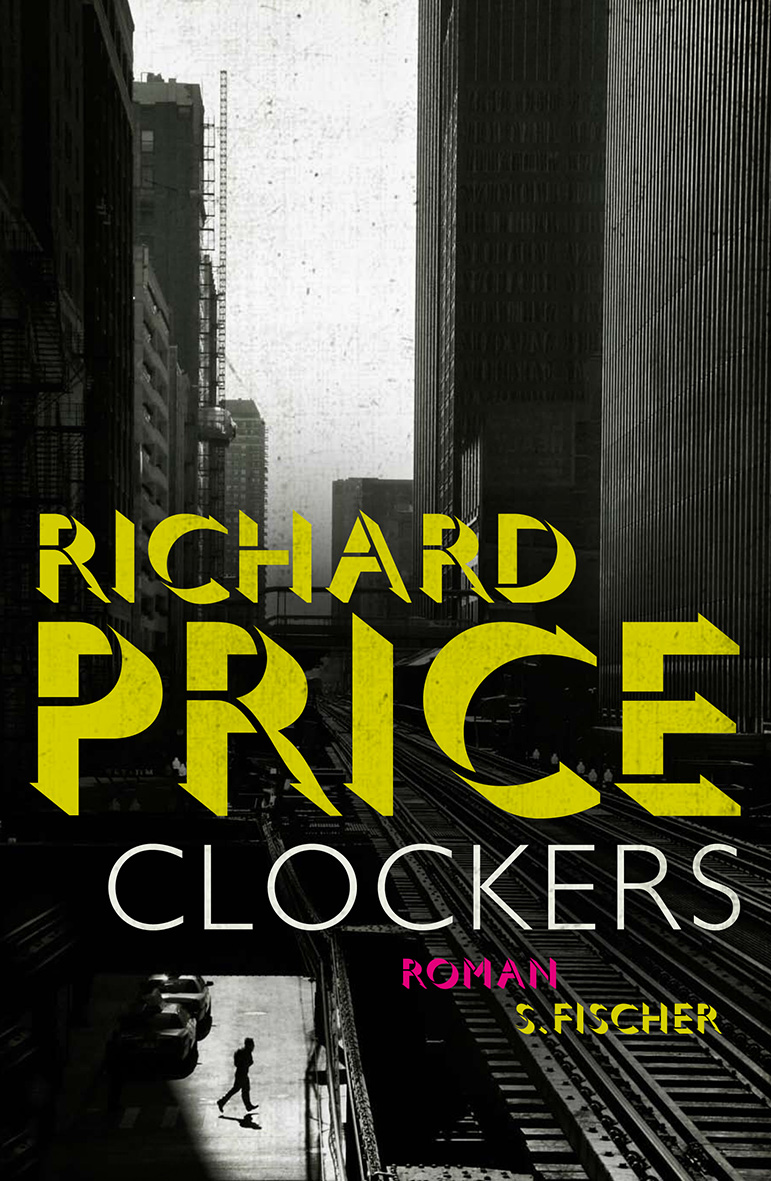 An „Cash“ von Richard Price habe ich mir zugegeber Maßen ziemlich die Zähne ausgebissen. Die zahlreichen Dialoge des Wälzers konnten schon mal für Verwirrung sorgen, wenn man als Leser nicht einen gewissen Wissensschatz bezüglich der Thematik mitbrachte. Umso neugieriger war ich auf den Nachfolgeroman (bzw. Vorgängerroman, die Originalausgabe stammt aus dem Jahr 1992 und ist bereits mit Harvey Keitel in der Hauptrolle von niemand Geringerem als Spike Lee verfilmt worden), der nun unter dem Namen „Clockers“ erscheint. Das Buch thematisiert die Geschichte um die Drogen und wie sie an den Endverbraucher gelangen. Angesiedelt in einer amerikanischen Metropole ist der Roman ein gefundenes Fressen für alle, die sich schon öfter gefragt haben, warum die hervorragende Serie „The Wire“ (an der auch der Autor mitarbeitete) eigentlich schon nach fünf Staffeln wieder eingetütet wurde. Im Grunde genommen dreht sich das Buch dabei um einen gewissen Strike, der im Verdacht steht, einen Mord begangen zu haben. Das wurde ihm wiederum auch so aufgetragen, allerdings bekommt er dann Gewissensbisse, was ihn aber keineswegs aus der Schusslinie der ermittelnden Beamten fegt. Der Roman begibt sich diesbezüglich auf Spurensuche nach dem Täter und arbeitet sich fortwährend daran ab, zu erläutern, wie der Drogenverkauf in einer großen Stadt organisiert ist. Gespickt mit zahlreichen Anekdoten aus dem echten Leben gelingt es Price seinen Lesern schonungslos vor Augen zu führen, wie schwierig es ist, wieder aus dem Schlamm zu kriechen, wenn man erstmal in den Drogensumpf rein gerutscht ist. „Strike sah auf die andere Straßenseite und suchte nach einer Art Zufluchtsstätte, einem dunklen Ort, um sich für eine Minute hinzusetzen, damit er sich wieder fassen konnte.“ Ob es ihm gelingt, das solltest du am Besten selbst herausfinden. Es lohnt sich.
An „Cash“ von Richard Price habe ich mir zugegeber Maßen ziemlich die Zähne ausgebissen. Die zahlreichen Dialoge des Wälzers konnten schon mal für Verwirrung sorgen, wenn man als Leser nicht einen gewissen Wissensschatz bezüglich der Thematik mitbrachte. Umso neugieriger war ich auf den Nachfolgeroman (bzw. Vorgängerroman, die Originalausgabe stammt aus dem Jahr 1992 und ist bereits mit Harvey Keitel in der Hauptrolle von niemand Geringerem als Spike Lee verfilmt worden), der nun unter dem Namen „Clockers“ erscheint. Das Buch thematisiert die Geschichte um die Drogen und wie sie an den Endverbraucher gelangen. Angesiedelt in einer amerikanischen Metropole ist der Roman ein gefundenes Fressen für alle, die sich schon öfter gefragt haben, warum die hervorragende Serie „The Wire“ (an der auch der Autor mitarbeitete) eigentlich schon nach fünf Staffeln wieder eingetütet wurde. Im Grunde genommen dreht sich das Buch dabei um einen gewissen Strike, der im Verdacht steht, einen Mord begangen zu haben. Das wurde ihm wiederum auch so aufgetragen, allerdings bekommt er dann Gewissensbisse, was ihn aber keineswegs aus der Schusslinie der ermittelnden Beamten fegt. Der Roman begibt sich diesbezüglich auf Spurensuche nach dem Täter und arbeitet sich fortwährend daran ab, zu erläutern, wie der Drogenverkauf in einer großen Stadt organisiert ist. Gespickt mit zahlreichen Anekdoten aus dem echten Leben gelingt es Price seinen Lesern schonungslos vor Augen zu führen, wie schwierig es ist, wieder aus dem Schlamm zu kriechen, wenn man erstmal in den Drogensumpf rein gerutscht ist. „Strike sah auf die andere Straßenseite und suchte nach einer Art Zufluchtsstätte, einem dunklen Ort, um sich für eine Minute hinzusetzen, damit er sich wieder fassen konnte.“ Ob es ihm gelingt, das solltest du am Besten selbst herausfinden. Es lohnt sich.
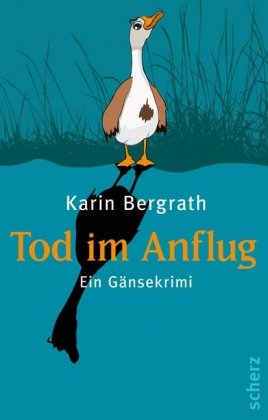 Wer derweil auf Schafskrimis und sonstige sympathische Absurditäten abfährt, der sollte sich mal das aktuelle Buch von Karin Bergrath reinziehen. „Tod im Anflug“ ist nämlich der neuste Beitrag zum Thema „tierische Ermittler“. In dem Gänsekrimi macht sich Gänserich Tom auf, die beiden Kommissare Rainers und Hump bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Ihm geht es dabei vorwiegend um einen toten Reiher namens Neptunus, der eines Morgens mit breit geöffnetem Schnabel und Loch in der Brust auf einen Campingplatz gefunden wird. Da ist es natürlich nicht schlecht, dass Grauganter Tom sich in der Vergangenheit einige CSI-Folgen zu Gemüte geführt hat, weshalb er sich selbst mal auf Spurensuche begibt. Er schnappt sich also seinen Assistenten Rio und dann geht’s los: „Der Tod kommt auf leisen Flügeln…“ und gäbe es ihn nicht, hätten die beiden Protagonisten weiter lustig am Seeufer herumpaddeln können und sich die Neuigkeiten der „Zeitungsenten“ (ja, die gibt’s hier wirklich) reinziehen können. Die Geschichte ist schmissig getextet und liest sich in einem Rutsch durch. Die Verdächtigen werden nahezu im Kapiteltakt durchdekliniert und es entspinnt sich ein geschickt gestrickter Mitratekrimi, der für ein kurzweiliges Lesevergnügen sorgt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Karin Bergrath liefert mit „Tod im Anflug“ routinierte Unterhaltung.
Wer derweil auf Schafskrimis und sonstige sympathische Absurditäten abfährt, der sollte sich mal das aktuelle Buch von Karin Bergrath reinziehen. „Tod im Anflug“ ist nämlich der neuste Beitrag zum Thema „tierische Ermittler“. In dem Gänsekrimi macht sich Gänserich Tom auf, die beiden Kommissare Rainers und Hump bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Ihm geht es dabei vorwiegend um einen toten Reiher namens Neptunus, der eines Morgens mit breit geöffnetem Schnabel und Loch in der Brust auf einen Campingplatz gefunden wird. Da ist es natürlich nicht schlecht, dass Grauganter Tom sich in der Vergangenheit einige CSI-Folgen zu Gemüte geführt hat, weshalb er sich selbst mal auf Spurensuche begibt. Er schnappt sich also seinen Assistenten Rio und dann geht’s los: „Der Tod kommt auf leisen Flügeln…“ und gäbe es ihn nicht, hätten die beiden Protagonisten weiter lustig am Seeufer herumpaddeln können und sich die Neuigkeiten der „Zeitungsenten“ (ja, die gibt’s hier wirklich) reinziehen können. Die Geschichte ist schmissig getextet und liest sich in einem Rutsch durch. Die Verdächtigen werden nahezu im Kapiteltakt durchdekliniert und es entspinnt sich ein geschickt gestrickter Mitratekrimi, der für ein kurzweiliges Lesevergnügen sorgt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Karin Bergrath liefert mit „Tod im Anflug“ routinierte Unterhaltung.
 In „Hemmersmoor“ dreht sich derweil alles um die Abgründe unseres menschlichen Daseins. Der Schauerroman setzt sich mit vier jungen Menschen auseinander, die in einem verschlafenen Nest aufwachsen, in welchem sich die Menschen noch intensiv mit ihrem Aberglauben auseinandersetzen. Stefan Kiesbye hat einen schaurigen Roman erschaffen, der sich leider vorwiegend an den grausamen Aspekten unseres Daseins abarbeitet. Dadurch vergibt der Schöpfer die Chance, seinen Figuren genug Tiefe (= Leben) einzuhauchen, weshalb ihr (mögliches) Ableben auch nicht wirklich für Angst und Schrecken beim Leser sorgt. „Hemmersmoor“ ist ein Roman für jene, die möglichst viele Schauergeschichten in einem Buch versammelt wissen möchten. In einer Umgebung der Angst sind die Kids umgeben von Lynchmördern, Feuerteufeln, Vergewaltigern und Kindsmördern. Das Spiel mit der Angst wird dadurch auf die Spitze getrieben, dass man sich anfangs sehr schwer tut, einen roten Faden im teuflischen Treiben zu entdecken. Nach einem Prolog, der sich in der Gegenwart ansiedelt, werden wir in die 50er Jahre zurückgespult und landen in einem alten norddeutschen Örtchen. Die Außenwelt scheint in Hemmersmoor keine wirklich große Rolle zu spielen. Jedenfalls wird sie in dem Buch nahezu vollkommen ausgespart. Das schafft Beklemmung. Der Roman ist dadurch nicht unbedingt leicht zu verdauen, wer sich aber durchkämpft und sich von den diversen Ich-Erzählern (die noch einmal zusätzlich für Verwirrung sorgen) nicht abschrecken lässt, wird mit einem Dorf-Krimi der Marke „Tannöd“ belohnt, der auf übersinnliche Momente weitestgehend verzichtet, das Irdische aber über 207 Seiten nur umso drastischer inszeniert. Womit wir auch schon wieder am Ende wären für heute. Also viel Spaß beim Schmökern. Wir „lesen“ uns.
In „Hemmersmoor“ dreht sich derweil alles um die Abgründe unseres menschlichen Daseins. Der Schauerroman setzt sich mit vier jungen Menschen auseinander, die in einem verschlafenen Nest aufwachsen, in welchem sich die Menschen noch intensiv mit ihrem Aberglauben auseinandersetzen. Stefan Kiesbye hat einen schaurigen Roman erschaffen, der sich leider vorwiegend an den grausamen Aspekten unseres Daseins abarbeitet. Dadurch vergibt der Schöpfer die Chance, seinen Figuren genug Tiefe (= Leben) einzuhauchen, weshalb ihr (mögliches) Ableben auch nicht wirklich für Angst und Schrecken beim Leser sorgt. „Hemmersmoor“ ist ein Roman für jene, die möglichst viele Schauergeschichten in einem Buch versammelt wissen möchten. In einer Umgebung der Angst sind die Kids umgeben von Lynchmördern, Feuerteufeln, Vergewaltigern und Kindsmördern. Das Spiel mit der Angst wird dadurch auf die Spitze getrieben, dass man sich anfangs sehr schwer tut, einen roten Faden im teuflischen Treiben zu entdecken. Nach einem Prolog, der sich in der Gegenwart ansiedelt, werden wir in die 50er Jahre zurückgespult und landen in einem alten norddeutschen Örtchen. Die Außenwelt scheint in Hemmersmoor keine wirklich große Rolle zu spielen. Jedenfalls wird sie in dem Buch nahezu vollkommen ausgespart. Das schafft Beklemmung. Der Roman ist dadurch nicht unbedingt leicht zu verdauen, wer sich aber durchkämpft und sich von den diversen Ich-Erzählern (die noch einmal zusätzlich für Verwirrung sorgen) nicht abschrecken lässt, wird mit einem Dorf-Krimi der Marke „Tannöd“ belohnt, der auf übersinnliche Momente weitestgehend verzichtet, das Irdische aber über 207 Seiten nur umso drastischer inszeniert. Womit wir auch schon wieder am Ende wären für heute. Also viel Spaß beim Schmökern. Wir „lesen“ uns.
UND WAS NUN?