 Attwenger legen die Latte gleich im Opener ihres aktuellen Album „Flux“ ziemlich hoch. Da wird nämlich direkt eine Referenz an Bill Withers „Ain´t No Sunshine When She´s Gone“ raus gehauen. Wie das Ganze dann mit einer volksmusikalischen Turbo-Attacke ad absurdum geführt wird, ist der reine Wahnsinn. Also Hände hoch und Abtanzen. Alles leuchtet, alles springt. Und mittendrin sorgt diese Platte für den passenden Flow. Die Songs klingen so abwechslungsreich wie nie zu vor. Swing, Rock, Polka und Brass-Klänge werden in einen Topf geworfen und mal eben durchlauf erhitzt, so dass man sich schon nach wenigen Sekunden die Gliedmaßen verrenkt. Wer nach sechs Studioalben aus dem hause Attwenger mit Abnutzungserscheinungen oder Erschöpfungssyndromen gerechnet hat, der sieht sich getäuscht. „Flux“ ist die „Bombe“. Der schubst dich auf die Tanzfläche, dieser Flow.
Attwenger legen die Latte gleich im Opener ihres aktuellen Album „Flux“ ziemlich hoch. Da wird nämlich direkt eine Referenz an Bill Withers „Ain´t No Sunshine When She´s Gone“ raus gehauen. Wie das Ganze dann mit einer volksmusikalischen Turbo-Attacke ad absurdum geführt wird, ist der reine Wahnsinn. Also Hände hoch und Abtanzen. Alles leuchtet, alles springt. Und mittendrin sorgt diese Platte für den passenden Flow. Die Songs klingen so abwechslungsreich wie nie zu vor. Swing, Rock, Polka und Brass-Klänge werden in einen Topf geworfen und mal eben durchlauf erhitzt, so dass man sich schon nach wenigen Sekunden die Gliedmaßen verrenkt. Wer nach sechs Studioalben aus dem hause Attwenger mit Abnutzungserscheinungen oder Erschöpfungssyndromen gerechnet hat, der sieht sich getäuscht. „Flux“ ist die „Bombe“. Der schubst dich auf die Tanzfläche, dieser Flow.
 Wer es gerne ein wenig entspannter mag, der darf sich in diesen Tagen über das neue Werk aus dem Hause Cocoon freuen. Das sympathische Duo macht mit seinem zweiten Album „Where The Oceans End“ all diejenigen glücklich, die sich bereits an den letzten Werken von Azure Ray und Mumford & Sons erfreuten. Allein der Opener „Sushi“ ist voll gestopft mit so viel Atmosphäre, dass man sich fühlt, als würde man durch einen Himmel voller Geigen wandeln. Alles auf diesem Album strahlt eine bedingungslose Naturverbundenheit aus, so dass sich auch die Lagerfeuer-Fraktion mit diesem stimmungsvollen Werk anfreunden dürfte. Wer auf kathedralischen Liedermacher-Pop steht, sollte sich dieses Werk voller verwunschener Chöre und weinender Streich(hölz)er auf keinen Fall entgehen lassen.
Wer es gerne ein wenig entspannter mag, der darf sich in diesen Tagen über das neue Werk aus dem Hause Cocoon freuen. Das sympathische Duo macht mit seinem zweiten Album „Where The Oceans End“ all diejenigen glücklich, die sich bereits an den letzten Werken von Azure Ray und Mumford & Sons erfreuten. Allein der Opener „Sushi“ ist voll gestopft mit so viel Atmosphäre, dass man sich fühlt, als würde man durch einen Himmel voller Geigen wandeln. Alles auf diesem Album strahlt eine bedingungslose Naturverbundenheit aus, so dass sich auch die Lagerfeuer-Fraktion mit diesem stimmungsvollen Werk anfreunden dürfte. Wer auf kathedralischen Liedermacher-Pop steht, sollte sich dieses Werk voller verwunschener Chöre und weinender Streich(hölz)er auf keinen Fall entgehen lassen.
 Unter dem Banner Ancient Astronauts erscheint in diesen Tagen ein verdammt gelungenes TripHop-Album, das ganz unverschämt an den Sound der Thievery Corporaton erinnert. Ist ja auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass „Into Bass And Time“ auf deren bandeigenem Label erscheint. Die Scheibe strotzt nur so vor atmosphärischen Momenten und sorgt mit allerhand Breakbeats und Funk-Klängen für einen klassischen Euphorieschub. Da hätten sich die Beastie Boys durchaus eine Scheibe von abschneiden können, wenn man sich im Gegensatz dazu deren letzten Instrumental-Output zu Gemüte führt. Hier passt jeder Ton. Der Bass brummt. Die Zeit rast. Augen schließen und weg.
Unter dem Banner Ancient Astronauts erscheint in diesen Tagen ein verdammt gelungenes TripHop-Album, das ganz unverschämt an den Sound der Thievery Corporaton erinnert. Ist ja auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass „Into Bass And Time“ auf deren bandeigenem Label erscheint. Die Scheibe strotzt nur so vor atmosphärischen Momenten und sorgt mit allerhand Breakbeats und Funk-Klängen für einen klassischen Euphorieschub. Da hätten sich die Beastie Boys durchaus eine Scheibe von abschneiden können, wenn man sich im Gegensatz dazu deren letzten Instrumental-Output zu Gemüte führt. Hier passt jeder Ton. Der Bass brummt. Die Zeit rast. Augen schließen und weg.
 All jene, die sich im vergangenen Jahr die äußerst gelungene Klamotte „Verrückt nach dir“ zu Gemüte geführt haben, dürften die Band The Boxer Rebellion inzwischen innigst ins Herz geschlossen haben. Mit ihrem emotional-dynamischen Mix aus Beatles-Gedächtnismomenten und stadiontaglichen Hymnen der Marke Coldplay, dürften sie die Melancholiefraktion nahezu mit links um den Finger wickeln. Auf ihrem Zweitwerk „The Cold Still“ lassen sie es in diesem Zusammenhang etwas ruhiger angehen, bevor sie dann einen Indie-Pop-Schmachtfetzen nach dem anderen aus dem Ärmel schütteln. Wer ein gewisses Faible für melancholisch-arrangierten Poprock mitbringt, findet hier massenhaft Futter, um sich seine eigene Variante der „O.C. California“-Mix-Reihe zu kompilieren.
All jene, die sich im vergangenen Jahr die äußerst gelungene Klamotte „Verrückt nach dir“ zu Gemüte geführt haben, dürften die Band The Boxer Rebellion inzwischen innigst ins Herz geschlossen haben. Mit ihrem emotional-dynamischen Mix aus Beatles-Gedächtnismomenten und stadiontaglichen Hymnen der Marke Coldplay, dürften sie die Melancholiefraktion nahezu mit links um den Finger wickeln. Auf ihrem Zweitwerk „The Cold Still“ lassen sie es in diesem Zusammenhang etwas ruhiger angehen, bevor sie dann einen Indie-Pop-Schmachtfetzen nach dem anderen aus dem Ärmel schütteln. Wer ein gewisses Faible für melancholisch-arrangierten Poprock mitbringt, findet hier massenhaft Futter, um sich seine eigene Variante der „O.C. California“-Mix-Reihe zu kompilieren.
 Schon auf dem letzt-jährigen „Berlin Festival“ haben Le Corps Mince De Francoise ein fulminantes Elektro-Pop-Feuerwerk abgebrannt. Mit knackigen Slogans und jeder Menge Enthusiasmus stürmten sie aus dem Stand auf Platz 1 der liebenswürdigsten Geheimtipps des Wochenendes, weil sie in bester Uffie-Manier die Tanzbeine der Anwesenden in Wallung versetzten. Das Debütalbum „Love And Nature“ stellt in diesem Zusammenhang vor allem dahingehend eine echte Herausforderung dar, weil so ein Partyprogramm auf Platte schnell mal für Gähnattacken sorgen kann. Das sympathische Pop-Duo aus Helsinki umschifft diesen Umstand, indem es sich nicht allein auf den Knallbonbon-Effekt der Marke Beastie Boys beschränkt, sondern sich zwischenzeitlich auch mal mit lässigen Parts like Lady Sovereign schmückt. Das hält die Platte über die komplette Lauflänge spannend und sorgt dafür, dass man mal wieder eine Gänseblümchenwiese frisieren möchte, um sie alles Anwesenden hinterrücks über den Schädel zu kippen. Ein sympathisches, blumiges und verdammt verpopptes Sommeralbum, alles andere als „bo-bo-bo bored“.
Schon auf dem letzt-jährigen „Berlin Festival“ haben Le Corps Mince De Francoise ein fulminantes Elektro-Pop-Feuerwerk abgebrannt. Mit knackigen Slogans und jeder Menge Enthusiasmus stürmten sie aus dem Stand auf Platz 1 der liebenswürdigsten Geheimtipps des Wochenendes, weil sie in bester Uffie-Manier die Tanzbeine der Anwesenden in Wallung versetzten. Das Debütalbum „Love And Nature“ stellt in diesem Zusammenhang vor allem dahingehend eine echte Herausforderung dar, weil so ein Partyprogramm auf Platte schnell mal für Gähnattacken sorgen kann. Das sympathische Pop-Duo aus Helsinki umschifft diesen Umstand, indem es sich nicht allein auf den Knallbonbon-Effekt der Marke Beastie Boys beschränkt, sondern sich zwischenzeitlich auch mal mit lässigen Parts like Lady Sovereign schmückt. Das hält die Platte über die komplette Lauflänge spannend und sorgt dafür, dass man mal wieder eine Gänseblümchenwiese frisieren möchte, um sie alles Anwesenden hinterrücks über den Schädel zu kippen. Ein sympathisches, blumiges und verdammt verpopptes Sommeralbum, alles andere als „bo-bo-bo bored“.
 Frederico Aubele entführt uns derweil in ein düsteres Zwischenreich gespickt mit Dub- und Gitarren-Passagen. Alles scheint zu schweben, wenn diese Musik dein Soundsystem flutet. „Berlin 13“ strotzt nur so vor elektroakustischen Eskapaden, die bei aller Tristesse doch immer eine gewisse Lebendigkeit ausstrahlen. Immer dann, wenn nämlich alles in Melancholie zu versinken droht, zieht einen eine schöne Melodie oder ein Pulsschlag wieder an die Oberfläche und sorgt so dafür, dass man nicht wegschlummert. Dieses Album sollte man sich am Besten mit Kopfhörern auf den Ohren zu Gemüte führen, während man eine dunkle Straße mit dem Fahrrad hinab schießt. Fühlt sich an, als würde man schweben zu dieser Musik.
Frederico Aubele entführt uns derweil in ein düsteres Zwischenreich gespickt mit Dub- und Gitarren-Passagen. Alles scheint zu schweben, wenn diese Musik dein Soundsystem flutet. „Berlin 13“ strotzt nur so vor elektroakustischen Eskapaden, die bei aller Tristesse doch immer eine gewisse Lebendigkeit ausstrahlen. Immer dann, wenn nämlich alles in Melancholie zu versinken droht, zieht einen eine schöne Melodie oder ein Pulsschlag wieder an die Oberfläche und sorgt so dafür, dass man nicht wegschlummert. Dieses Album sollte man sich am Besten mit Kopfhörern auf den Ohren zu Gemüte führen, während man eine dunkle Straße mit dem Fahrrad hinab schießt. Fühlt sich an, als würde man schweben zu dieser Musik.
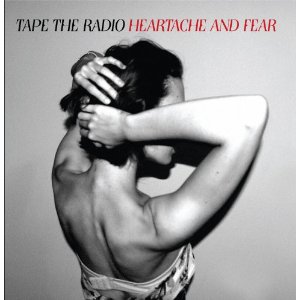 Das erste Album von Tape The Radio wurde derweil von niemand Geringerem als Jim Lowe produziert, der schon bei den Foo Fighters hinter den Reglern stand. „Heartache And Fear“ klingt dann allerdings überraschend atmosphärisch, so als hätten Coldplay plötzlich mit Keane fusioniert und sich hin und wieder eine Melodie bei Glasvegas abgebauscht. Bei so viel Namedropping ist es bemerkenswert, dass man der Band trotzdem gerne zuhört. Man merkt der Crew an, dass sie keine Kompromisse machen möchte. Der Club wird einfach ausgelassen. Tape The Radio wollen gleich ins Stadion. Ob das funktioniert? Warten wir es ab.
Das erste Album von Tape The Radio wurde derweil von niemand Geringerem als Jim Lowe produziert, der schon bei den Foo Fighters hinter den Reglern stand. „Heartache And Fear“ klingt dann allerdings überraschend atmosphärisch, so als hätten Coldplay plötzlich mit Keane fusioniert und sich hin und wieder eine Melodie bei Glasvegas abgebauscht. Bei so viel Namedropping ist es bemerkenswert, dass man der Band trotzdem gerne zuhört. Man merkt der Crew an, dass sie keine Kompromisse machen möchte. Der Club wird einfach ausgelassen. Tape The Radio wollen gleich ins Stadion. Ob das funktioniert? Warten wir es ab.
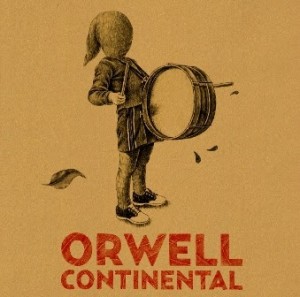 Orwell machen sich derweil nicht daran, der Welt weitere Überwachungsstaat-Phantasien vorzustellen, sie entwerfen lieber ein subtil-anmutendes Elektro-Pop-Album, an dem Fans von Phoenix bis Pet Shop Boys ihre helle Freude haben dürften. „Continental“ lebt von seiner französischen Lässigkeit und seinen zärtlichen Melodien, die auch aus der Feder von Belle & Sebastian stammen könnten. Wer sich in der Vergangenheit am Sound von Brian Eno bis Stereolab erfreute, kann durchaus mal einen Durchlauf riskieren. Und wir sind erstmal raus für heute. Bis bald mal wieder. Beim nächsten Zuckerbeat.
Orwell machen sich derweil nicht daran, der Welt weitere Überwachungsstaat-Phantasien vorzustellen, sie entwerfen lieber ein subtil-anmutendes Elektro-Pop-Album, an dem Fans von Phoenix bis Pet Shop Boys ihre helle Freude haben dürften. „Continental“ lebt von seiner französischen Lässigkeit und seinen zärtlichen Melodien, die auch aus der Feder von Belle & Sebastian stammen könnten. Wer sich in der Vergangenheit am Sound von Brian Eno bis Stereolab erfreute, kann durchaus mal einen Durchlauf riskieren. Und wir sind erstmal raus für heute. Bis bald mal wieder. Beim nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?