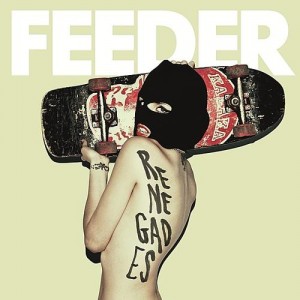 Fans von Feeder werden sich heftig die Augäpfel massieren, wenn sie das neue Album der Jungs voller Vorfreude in den CD-Spieler schubsen. „Renegades“ ist nämlich, wie auch das neue Werk der Foo Fighters, ein brachiales Rockbrett und erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem man die Band schon endgültig an das Formatradio zu verlieren geglaubt hatte. Im Hauptprogramm wird jedenfalls kaum einen dieser treibenden Rocksongs laufen. Dafür wird bald in jeder Indie-Disco zu der Hymne „Call Out“ im Dreieck gesprungen. Das hier ist genau das Album, nach dem sich die Fans oller Brettern der Marke „Buck Rogers“ immer gesehnt haben. Alles pulsiert. Alles explodiert. Danke, Tocotronic. Wer auf Alternative-Rock-Tracks mit reichlich Feuer unterm Popo steht, der sollte zu Feeder ins Cockpit steigen und sich von dieser Rockrakete in Richtung Glückseligkeit ballern lassen.
Fans von Feeder werden sich heftig die Augäpfel massieren, wenn sie das neue Album der Jungs voller Vorfreude in den CD-Spieler schubsen. „Renegades“ ist nämlich, wie auch das neue Werk der Foo Fighters, ein brachiales Rockbrett und erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem man die Band schon endgültig an das Formatradio zu verlieren geglaubt hatte. Im Hauptprogramm wird jedenfalls kaum einen dieser treibenden Rocksongs laufen. Dafür wird bald in jeder Indie-Disco zu der Hymne „Call Out“ im Dreieck gesprungen. Das hier ist genau das Album, nach dem sich die Fans oller Brettern der Marke „Buck Rogers“ immer gesehnt haben. Alles pulsiert. Alles explodiert. Danke, Tocotronic. Wer auf Alternative-Rock-Tracks mit reichlich Feuer unterm Popo steht, der sollte zu Feeder ins Cockpit steigen und sich von dieser Rockrakete in Richtung Glückseligkeit ballern lassen.
 Holy Ghost! entwickeln sich derweil immer weiter in Richtung Pop. Ihr aktuelles Album wird auf jeden Fall all jenen gefallen, die sich schon immer nach einem musikalischen Zwitter aus MGMT und dem LCD Soundsystem verzehrt haben. Das gleichnamige Werk ist gespickt mit tanzbaren Indie-Pop-Songs, die einen sofort in die 80er zurückschubsen. Allein die Single „Wait And See“ ist ihr Eintrittsgeld wert. Schon tänzelt man durch Nebelschwaden auf das Objekt der Begierde zu, um sich im Blitzlichtgewitter ganz abenteuerlustig ganz tief in die Augen zu blicken. Mit diesem Album werden Holy Ghost! vielleicht den einen oder anderen Fan von früher vergrätzen, weil der sich schon auf einige neue, treibende Rhythmen der Jungs gefreut hatte. Dafür wird ihnen für einen Track wie „Hold My Breath“ die komplette Phoenix-Fraktion um den Hals fallen.
Holy Ghost! entwickeln sich derweil immer weiter in Richtung Pop. Ihr aktuelles Album wird auf jeden Fall all jenen gefallen, die sich schon immer nach einem musikalischen Zwitter aus MGMT und dem LCD Soundsystem verzehrt haben. Das gleichnamige Werk ist gespickt mit tanzbaren Indie-Pop-Songs, die einen sofort in die 80er zurückschubsen. Allein die Single „Wait And See“ ist ihr Eintrittsgeld wert. Schon tänzelt man durch Nebelschwaden auf das Objekt der Begierde zu, um sich im Blitzlichtgewitter ganz abenteuerlustig ganz tief in die Augen zu blicken. Mit diesem Album werden Holy Ghost! vielleicht den einen oder anderen Fan von früher vergrätzen, weil der sich schon auf einige neue, treibende Rhythmen der Jungs gefreut hatte. Dafür wird ihnen für einen Track wie „Hold My Breath“ die komplette Phoenix-Fraktion um den Hals fallen.
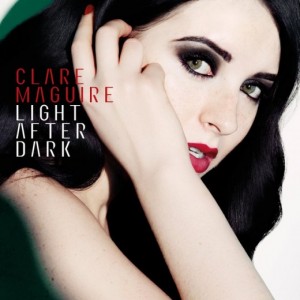 Anschließend widmen wir uns mal ein wenig den Spitzenpositionen der Charts und stoßen dort auf eine gewisse Clare Maguire, die mit ihrem ersten Album nicht nur Jay-Z von sich zu überzeugen wusste, sondern mit ihrer Musik auch den Rest des britischen Königreichs um den kleinen Finger wickelte. „Light After Dark“ hat alles, was ein gutes Pop-Album braucht. Nur steht es nicht etwa in der Tradition der Heulbojen aus den Hochglanzmagazinen, sondern eher in einer Reihe mit dem doppelbödigen Disco-Pop von Sophie Ellis Baxter (oder gerne auch Ellie Goulding). Soll heißen: es darf zwar gerne zu dieser Musik getanzt werden, die Scheibe klingt aber trotzdem nicht so gleichgeschaltet, wie viele der Timbaland und Konsorten-Acts, die in letzter Zeit den Markt überfluteten.
Anschließend widmen wir uns mal ein wenig den Spitzenpositionen der Charts und stoßen dort auf eine gewisse Clare Maguire, die mit ihrem ersten Album nicht nur Jay-Z von sich zu überzeugen wusste, sondern mit ihrer Musik auch den Rest des britischen Königreichs um den kleinen Finger wickelte. „Light After Dark“ hat alles, was ein gutes Pop-Album braucht. Nur steht es nicht etwa in der Tradition der Heulbojen aus den Hochglanzmagazinen, sondern eher in einer Reihe mit dem doppelbödigen Disco-Pop von Sophie Ellis Baxter (oder gerne auch Ellie Goulding). Soll heißen: es darf zwar gerne zu dieser Musik getanzt werden, die Scheibe klingt aber trotzdem nicht so gleichgeschaltet, wie viele der Timbaland und Konsorten-Acts, die in letzter Zeit den Markt überfluteten.
 James Pants nennt sich derweil ein illustrer Künstler aus dem Hause „Stones Throw“, ein renommiertes Label, das uns in der Vergangenheit schon allerhand charmante Rap- und Funkperlen bescherte. Das gleichnamige Album des Musikers allerdings wildert lieber in Krautrock-Gefilden. Schon im Opener wird Neu! und Faust gehuldigt und auch sonst geht’s ziemlich drunter und drüber. Das Album setzt sich zusammen aus Garage-Rock-Tracks, die hinter einem verrauschten Schleier gepackt werden und dann von brachialen Lärmgewittern unterbrochen werden. Klingt im ersten Moment ziemlich anstrengend, entpuppt sich dann aber als äußerst aufregendes Erlebnis im Grenzgebiet von Surf Pop der Marke Best Coast und Krautwickel der Marke Can. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Stimmt! Das müsst ihr erleben…
James Pants nennt sich derweil ein illustrer Künstler aus dem Hause „Stones Throw“, ein renommiertes Label, das uns in der Vergangenheit schon allerhand charmante Rap- und Funkperlen bescherte. Das gleichnamige Album des Musikers allerdings wildert lieber in Krautrock-Gefilden. Schon im Opener wird Neu! und Faust gehuldigt und auch sonst geht’s ziemlich drunter und drüber. Das Album setzt sich zusammen aus Garage-Rock-Tracks, die hinter einem verrauschten Schleier gepackt werden und dann von brachialen Lärmgewittern unterbrochen werden. Klingt im ersten Moment ziemlich anstrengend, entpuppt sich dann aber als äußerst aufregendes Erlebnis im Grenzgebiet von Surf Pop der Marke Best Coast und Krautwickel der Marke Can. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Stimmt! Das müsst ihr erleben…
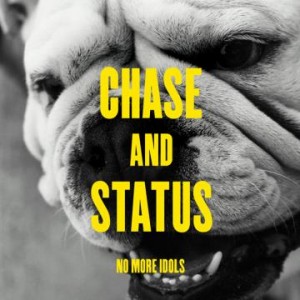 Chase & Status wagen derweil den Sprung ins Showgeschäft und lassen sich auf ihrem zweiten Album von allerhand Illustren Gaststars befeuern. Plan B, Dizzee Rascal und die White Lies sorgen dafür, dass man als Hörer einen a ha-Effekt nach den Anderen erfährt. Auch die Fans von The Prodigy dürfen sich freuen, denn „No More Idols“ liefert zahlreiche Gründe, sich auf dem nächsten großen Musikfestival mal so richtig hemmungslos auszutoben. Dieses Album ist ganz bewusst auf den großen Blitzlicht-Moment zugeschnitten, die Drum´n´Bass-Anleihen des Vorgängers sind nur noch in Nuancen erkennbar. Stattdessen bekommt man Breitwand-Pop der Marke Pendulum vor den Latz geknallt. Alles in allem ein durchaus gelungenes Unterfangen, auch wenn einige Hörer sicher etwas ganz anderes erwartet haben.
Chase & Status wagen derweil den Sprung ins Showgeschäft und lassen sich auf ihrem zweiten Album von allerhand Illustren Gaststars befeuern. Plan B, Dizzee Rascal und die White Lies sorgen dafür, dass man als Hörer einen a ha-Effekt nach den Anderen erfährt. Auch die Fans von The Prodigy dürfen sich freuen, denn „No More Idols“ liefert zahlreiche Gründe, sich auf dem nächsten großen Musikfestival mal so richtig hemmungslos auszutoben. Dieses Album ist ganz bewusst auf den großen Blitzlicht-Moment zugeschnitten, die Drum´n´Bass-Anleihen des Vorgängers sind nur noch in Nuancen erkennbar. Stattdessen bekommt man Breitwand-Pop der Marke Pendulum vor den Latz geknallt. Alles in allem ein durchaus gelungenes Unterfangen, auch wenn einige Hörer sicher etwas ganz anderes erwartet haben.
 Und eines war ja schon von vorne herein klar. Hercules & Love Affair würden nach dem Abgang von Antony ziemlich viel Mühe habe, über die hohe Latte drüber zu hüpfen, die sie mit ihrem Debüt vorgelegt haben. Auf „Blue Songs“ wird dementsprechend erstmal weniger dick aufgetragen. Auch ein neues „Blind“ will sich nach mehreren Durchläufen einfach nicht aus den Boxen schälen. Stattdessen erhält man ein stimmiges Gesamtpaket, das vor allem im Albumkontext Sinn ergibt. Es verhält sich mit der Scheibe ähnlich, wie mit dem Zweitling von MGMT. Der benötigte auch eine ganze Menge Zeit, um sich schließlich nur umso nachhaltiger in den Gehörgängen der Hörerschaft festzusetzen. „Blue Songs“ ist ein Album, das einen belohnt, für seine Geduld. Ein Werk, das man sich am Besten über Headphones zu Gemüte führt. Erst dann offenbaren sich alle Aspekte dieser so detail-versessenen Tracks. Erst dann beginnt man zu schweben, wenn einen die Streicher des Openers einlullen. Erst dann entführt einen die Platte in eine andere, weitaus elegantere Welt. Ein bemerkenswerter Zweitling eines bemerkenswerten Kollektivs.
Und eines war ja schon von vorne herein klar. Hercules & Love Affair würden nach dem Abgang von Antony ziemlich viel Mühe habe, über die hohe Latte drüber zu hüpfen, die sie mit ihrem Debüt vorgelegt haben. Auf „Blue Songs“ wird dementsprechend erstmal weniger dick aufgetragen. Auch ein neues „Blind“ will sich nach mehreren Durchläufen einfach nicht aus den Boxen schälen. Stattdessen erhält man ein stimmiges Gesamtpaket, das vor allem im Albumkontext Sinn ergibt. Es verhält sich mit der Scheibe ähnlich, wie mit dem Zweitling von MGMT. Der benötigte auch eine ganze Menge Zeit, um sich schließlich nur umso nachhaltiger in den Gehörgängen der Hörerschaft festzusetzen. „Blue Songs“ ist ein Album, das einen belohnt, für seine Geduld. Ein Werk, das man sich am Besten über Headphones zu Gemüte führt. Erst dann offenbaren sich alle Aspekte dieser so detail-versessenen Tracks. Erst dann beginnt man zu schweben, wenn einen die Streicher des Openers einlullen. Erst dann entführt einen die Platte in eine andere, weitaus elegantere Welt. Ein bemerkenswerter Zweitling eines bemerkenswerten Kollektivs.
 Wer auf gute Fernsehunterhaltung steht, kommt an der vielfach ausgezeichneten TV-Soap „Mad Men“ nicht mehr vorbei. „Mad Men“ steht in der Tradition der großen Serien Marke Sopranos oder The Wire, wildert aber in werbetechnischen Gefilden. Die differenziert gezeichneten Hauptpersonen wurden passend dazu in die 60er verfrachtet, wo sie sich zunehmend mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert sehen. Das ist vor allem deshalb so bemerkenswert, weil all das immer im Antlitz des schönen Scheins geschieht, welchen einen die Werbeindustrie vorzugaukeln versucht. Ebenso bemerkenswert wie die Ausstattung im 60er Jahre Stil ist aber die Musik. Sie transferiert ganz vorzüglich den Zeitgeist von damals ins Hier und Jetzt und erscheint jetzt endlich auf zwei Silberlingen, die mit 33 Tracks von Connie Francis bis Chuck Berry / Ricky Nelson bis Dusty Springfield bestückt sind. „A Musical Companion (1960-1965)“ beschränkt sich dabei nicht nur auf die großen Klassiker der 60er Jahre, sondern liefert auch ein paar „schmerzlich“ vermisste Perlen. Wer sich also für zwei Stunden in eine längst verstrichene Zeit zurückspulen möchte, muss nur die Augen schließen und diese Scheibe(n) hier auflegen. Es lohnt sich.
Wer auf gute Fernsehunterhaltung steht, kommt an der vielfach ausgezeichneten TV-Soap „Mad Men“ nicht mehr vorbei. „Mad Men“ steht in der Tradition der großen Serien Marke Sopranos oder The Wire, wildert aber in werbetechnischen Gefilden. Die differenziert gezeichneten Hauptpersonen wurden passend dazu in die 60er verfrachtet, wo sie sich zunehmend mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert sehen. Das ist vor allem deshalb so bemerkenswert, weil all das immer im Antlitz des schönen Scheins geschieht, welchen einen die Werbeindustrie vorzugaukeln versucht. Ebenso bemerkenswert wie die Ausstattung im 60er Jahre Stil ist aber die Musik. Sie transferiert ganz vorzüglich den Zeitgeist von damals ins Hier und Jetzt und erscheint jetzt endlich auf zwei Silberlingen, die mit 33 Tracks von Connie Francis bis Chuck Berry / Ricky Nelson bis Dusty Springfield bestückt sind. „A Musical Companion (1960-1965)“ beschränkt sich dabei nicht nur auf die großen Klassiker der 60er Jahre, sondern liefert auch ein paar „schmerzlich“ vermisste Perlen. Wer sich also für zwei Stunden in eine längst verstrichene Zeit zurückspulen möchte, muss nur die Augen schließen und diese Scheibe(n) hier auflegen. Es lohnt sich.
 Robag Whrume wiederum erschafft in der Zwischenzeit ein paar verzwickte Klangräume, die man sich am Liebsten im Surround Sound zu Gemüte führt. „Thora Vukk“ ist ein gefundenes Fressen für Minimalisten, wurde aber dennoch so voll gestopft mit hübschen Ideen, dass sich soundtechnisch auch alle Fans von Fever Ray / The Knife einen Durchlauf genehmigen sollten. Das Werk strahlt eine bedrückende Atmosphäre aus und klingt, als wollte Whrume die Hintergrundmusik zu einer Zombie-Choreographie inszenieren. Wer auf minimalistische Elektro-Phantasien mit Überraschungseffekten steht, der sollte unbedingt mal reinhören. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Robag Whrume wiederum erschafft in der Zwischenzeit ein paar verzwickte Klangräume, die man sich am Liebsten im Surround Sound zu Gemüte führt. „Thora Vukk“ ist ein gefundenes Fressen für Minimalisten, wurde aber dennoch so voll gestopft mit hübschen Ideen, dass sich soundtechnisch auch alle Fans von Fever Ray / The Knife einen Durchlauf genehmigen sollten. Das Werk strahlt eine bedrückende Atmosphäre aus und klingt, als wollte Whrume die Hintergrundmusik zu einer Zombie-Choreographie inszenieren. Wer auf minimalistische Elektro-Phantasien mit Überraschungseffekten steht, der sollte unbedingt mal reinhören. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?