 Sacha Sperling wird ja in diesen Tagen gerne auf eine Stufe mit Helene Hegemann gestellt, wenn es darum geht, den Exzess auf Papier zu überführen. Dabei ist sein Roman „Ich dich auch nicht“ dem Schmöker von Hegemann schon deshalb eine Nasenlänge voraus, weil der Autor in dem Roman nicht immer wieder den Faden verliert Schrägstrich die Geschichte ins Leere laufen lässt. Während Hegemann ihr Buch zunehmend mit Passagen durchsetzt, die das Voranschreiten der Handlung zu hemmen scheinen, macht sich Sperling ziel gerichtet daran, den Protagonisten seines Buches mit sich selbst zu konfrontieren. Während er nämlich Wodka klaut und Mädchen flachlegt, muss er sich zunehmend damit auseinander setzen, dass er sich unweigerlich in Augustin verliebt. Einen charismatischen Kerl, mit dem er seinen Exzessen frönt. Bemerkenswert ist der Sprachstil des Buches, der immer wieder ins Poetische gleitet: „Die ersten Schultage sind eine Serie verschwommener, trostloser Bilder, wie verwackelte, hastig geschossene Fotos“. Durch Zeilen wie diese macht der Autor deutlich, wie hoffnungslos verloren sich Menschen eigentlich fühlen müssen, wenn sie irgendwann feststellen, dass die Anreize, die das System ihnen liefert, für sie selbst keine Bedeutung haben. Sehen sich eben diese Menschen dann mit einer Situation konfrontiert, welche sie persönlich überfordert, bietet das System keinen Halt mehr. Sie entfremden sich von all dem, was sie umgibt. Sie sehnen sich nach etwas, mit dem sie das Gefühl überdecken können. Sie beginnen zu fliehen: vor sich selbst, vor ihren Gefühlen, vor der Welt. Weil sie nie etwas anderes gelernt haben. Weil sie noch nicht bereit sind, sich mit der Fragestellung zu konfrontieren, deren Antwort sie bereits zu kennen glauben. „Ich dich auch nicht“ wirft die Frage auf, was schlimmer ist: das Unvollendete auszukosten oder die Konsequenzen zu ertragen. Wie sich der Hauptdarsteller letztlich entscheidet? Hier lohnt es sich, das selbst herauszufinden.
Sacha Sperling wird ja in diesen Tagen gerne auf eine Stufe mit Helene Hegemann gestellt, wenn es darum geht, den Exzess auf Papier zu überführen. Dabei ist sein Roman „Ich dich auch nicht“ dem Schmöker von Hegemann schon deshalb eine Nasenlänge voraus, weil der Autor in dem Roman nicht immer wieder den Faden verliert Schrägstrich die Geschichte ins Leere laufen lässt. Während Hegemann ihr Buch zunehmend mit Passagen durchsetzt, die das Voranschreiten der Handlung zu hemmen scheinen, macht sich Sperling ziel gerichtet daran, den Protagonisten seines Buches mit sich selbst zu konfrontieren. Während er nämlich Wodka klaut und Mädchen flachlegt, muss er sich zunehmend damit auseinander setzen, dass er sich unweigerlich in Augustin verliebt. Einen charismatischen Kerl, mit dem er seinen Exzessen frönt. Bemerkenswert ist der Sprachstil des Buches, der immer wieder ins Poetische gleitet: „Die ersten Schultage sind eine Serie verschwommener, trostloser Bilder, wie verwackelte, hastig geschossene Fotos“. Durch Zeilen wie diese macht der Autor deutlich, wie hoffnungslos verloren sich Menschen eigentlich fühlen müssen, wenn sie irgendwann feststellen, dass die Anreize, die das System ihnen liefert, für sie selbst keine Bedeutung haben. Sehen sich eben diese Menschen dann mit einer Situation konfrontiert, welche sie persönlich überfordert, bietet das System keinen Halt mehr. Sie entfremden sich von all dem, was sie umgibt. Sie sehnen sich nach etwas, mit dem sie das Gefühl überdecken können. Sie beginnen zu fliehen: vor sich selbst, vor ihren Gefühlen, vor der Welt. Weil sie nie etwas anderes gelernt haben. Weil sie noch nicht bereit sind, sich mit der Fragestellung zu konfrontieren, deren Antwort sie bereits zu kennen glauben. „Ich dich auch nicht“ wirft die Frage auf, was schlimmer ist: das Unvollendete auszukosten oder die Konsequenzen zu ertragen. Wie sich der Hauptdarsteller letztlich entscheidet? Hier lohnt es sich, das selbst herauszufinden.
 Wer sich derweil schon immer mal gefragt hat, wie sich das wohl auf die eigene Psyche auswirken würde, einige Wochen in einer Klapsmühle zu verbringen, der sollte sich mal an den aktuellen Roman von Eva Lohrmann heranwagen. In „Acht Wochen verrückt“ schlägt sich unsere Romanheldin zwei Monate mit allerhand Wahnsinn herum und sieht sich in diesem Zusammenhang auch zunehmend mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert. Das Buch gleicht einem Selbstfindungstrip, wobei die ironische, sehr distanzierte, aber über weite Strecken auch witzige Art der Autorin, das schwierige Thema „Depression“ aufzugreifen, durchaus für die eine oder andere Grinsebacke beim Leser sorgen sollte. Nachdem Mila sich zunehmend mit ihrem Job überfordert fühlt, bricht sie irgendwann zusammen und lässt sich einliefern. Im Rahmen der Therapie lernt sie schließlich, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Sie sieht sich mit ihren Süchten und Ängsten konfrontiert, die von Tablettesucht bis hin zu Verlustängsten reichen. Die Autorin orientiert sich dabei streng am Klinikalltag, was dazu beiträgt, dass die Geschichte niemals unrealistisch anmutet. Am Ende stellt sich dann nicht nur für Mila, sondern auch für den Leser die Frage: Soll ich jetzt die Bremse ziehen oder weiter machen wie bisher? Wie er/sie sich entscheidet? Am Besten du liest selber mal nach.
Wer sich derweil schon immer mal gefragt hat, wie sich das wohl auf die eigene Psyche auswirken würde, einige Wochen in einer Klapsmühle zu verbringen, der sollte sich mal an den aktuellen Roman von Eva Lohrmann heranwagen. In „Acht Wochen verrückt“ schlägt sich unsere Romanheldin zwei Monate mit allerhand Wahnsinn herum und sieht sich in diesem Zusammenhang auch zunehmend mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert. Das Buch gleicht einem Selbstfindungstrip, wobei die ironische, sehr distanzierte, aber über weite Strecken auch witzige Art der Autorin, das schwierige Thema „Depression“ aufzugreifen, durchaus für die eine oder andere Grinsebacke beim Leser sorgen sollte. Nachdem Mila sich zunehmend mit ihrem Job überfordert fühlt, bricht sie irgendwann zusammen und lässt sich einliefern. Im Rahmen der Therapie lernt sie schließlich, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Sie sieht sich mit ihren Süchten und Ängsten konfrontiert, die von Tablettesucht bis hin zu Verlustängsten reichen. Die Autorin orientiert sich dabei streng am Klinikalltag, was dazu beiträgt, dass die Geschichte niemals unrealistisch anmutet. Am Ende stellt sich dann nicht nur für Mila, sondern auch für den Leser die Frage: Soll ich jetzt die Bremse ziehen oder weiter machen wie bisher? Wie er/sie sich entscheidet? Am Besten du liest selber mal nach.
 Der Preis der Leipziger Buchmesse ging in diesen Jahr an ein ganz besonderes Werk. „Notizhefte“ von Henning Ritter ist genau genommen kein Roman, das Buch ist eine Textsammlung, die sich daran macht, die Gedanken von Rousseau, Darwin und vielen anderen unter den unterschiedlichsten Gesichtspunkten zu betrachten. Dabei steckt das Werk voller Widersprüche. Der Autor will seine Leser dazu anregen, sich selbst mit den zahllosen Thesen und Gedanken auseinander zu setzen. Was an diesem Buch allerdings wirklich bemerkenswert ist, ist die lockere Art und Weise, mit welcher auch die schwierigsten Denkansätze abgehandelt werden. Das hat sicher auch damit zu tun, dass viele in diesem Buch hier überhaupt nicht veröffentlicht werden sollte. Man muss sich diesen Roman in etwa als Roundtable vorstellen, an der sich die größten Denker der vergangenen Jahrhunderte zum Schlagabtausch verabreden. Henning Ritter versteht sich in diesem Zusammenhang vor allem als Moderator, als derjenige, der versucht das Gesagte zu bündeln und es seinem Publikum vor den Latz zu knallen. Dass er sich dabei nicht verheddert, ist eine literarische Großtat und dürfte auch der langjährigen Arbeit des Autors für eine große deutsche Tageszeitung geschuldet sein. Es sind 25 Jahre Arbeit, die in diesem Werk stecken. All das führt zu Sätzen wie „Die Neigung zu Prognosen hängt mit einer Wahrnehmungsschwäche gegenüber der Wirklichkeit zusammen“. Wenn mich also meine Wahrnehmungsschwäche nicht täuscht, wird man über die „Notizhefte“ noch in 25 Jahren diskutieren. Einfach großartig, dieses Buch.
Der Preis der Leipziger Buchmesse ging in diesen Jahr an ein ganz besonderes Werk. „Notizhefte“ von Henning Ritter ist genau genommen kein Roman, das Buch ist eine Textsammlung, die sich daran macht, die Gedanken von Rousseau, Darwin und vielen anderen unter den unterschiedlichsten Gesichtspunkten zu betrachten. Dabei steckt das Werk voller Widersprüche. Der Autor will seine Leser dazu anregen, sich selbst mit den zahllosen Thesen und Gedanken auseinander zu setzen. Was an diesem Buch allerdings wirklich bemerkenswert ist, ist die lockere Art und Weise, mit welcher auch die schwierigsten Denkansätze abgehandelt werden. Das hat sicher auch damit zu tun, dass viele in diesem Buch hier überhaupt nicht veröffentlicht werden sollte. Man muss sich diesen Roman in etwa als Roundtable vorstellen, an der sich die größten Denker der vergangenen Jahrhunderte zum Schlagabtausch verabreden. Henning Ritter versteht sich in diesem Zusammenhang vor allem als Moderator, als derjenige, der versucht das Gesagte zu bündeln und es seinem Publikum vor den Latz zu knallen. Dass er sich dabei nicht verheddert, ist eine literarische Großtat und dürfte auch der langjährigen Arbeit des Autors für eine große deutsche Tageszeitung geschuldet sein. Es sind 25 Jahre Arbeit, die in diesem Werk stecken. All das führt zu Sätzen wie „Die Neigung zu Prognosen hängt mit einer Wahrnehmungsschwäche gegenüber der Wirklichkeit zusammen“. Wenn mich also meine Wahrnehmungsschwäche nicht täuscht, wird man über die „Notizhefte“ noch in 25 Jahren diskutieren. Einfach großartig, dieses Buch.
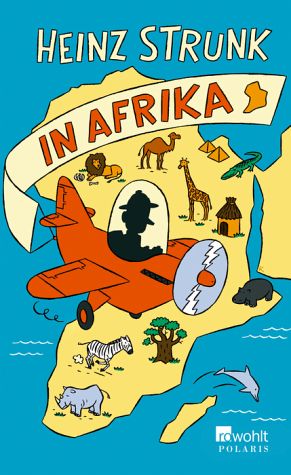 Der Name Heinz Strunk, seines Zeichens Autor, Entertainer, Musiker, und Politiker (in alphabetischer Reihenfolge) dürfte dem jung gebliebenen Leser durch seine Romane „Fleisch ist mein Gemüse“ (wurde 2005 verfilmt) und „Fleckenteufel“ bereits bekannt sein. Dem (hanseatischen) Radiohörer ist er möglicherweise durch seine Auftritte mit der Telefon-Comedy-Crew „Studio Braun“ aufgefallen. In seinem aktuellen Roman „In Afrika“ schreibt er über eine weihnachtliche Kenia-Reise der beiden Kumpels H. und C – zeitgleich zu den dortigen Präsidentschaftswahlen. Ziel des Urlaubs ist nicht das Abenteuer an sich, sondern die Suche nach der Langeweile, was einen immer gleichen Tagesablauf voraus setzt: Struktur-gebend ist dabei lediglich die Einnahme von Mahlzeiten. Nach einigen Tagen rücken die beiden ihrem Ziel bereits näher, die Poolbars beginnen zu langweilen und auch die Casinos geben nicht mehr viel her. Die Beiden entschließen sich deshalb nach Mombasa zu fahren. Durch die dortigen Unruhen nach einer (angeblich) gefälschten Wahl verliert sich das Duo für kurze Zeit aus den Augen, C. schafft es dann aber doch wieder ins Hotel zurück. Für „eingefleischte“ Heinz Strunk-Fans ist „In Afrika“ auf jeden Fall ein Muss. Dem Freund von „junger Kultur“ – trotz des Jahrgangs 1962 des Autors – dürfte wohl eher die Lesung zu empfehlen sein. Die eigenwillige Betonung und der sich daraus entwickelnde Wortwitz von Herrn Strunk geht in Schriftform leider etwas verloren. (K. Reschke)
Der Name Heinz Strunk, seines Zeichens Autor, Entertainer, Musiker, und Politiker (in alphabetischer Reihenfolge) dürfte dem jung gebliebenen Leser durch seine Romane „Fleisch ist mein Gemüse“ (wurde 2005 verfilmt) und „Fleckenteufel“ bereits bekannt sein. Dem (hanseatischen) Radiohörer ist er möglicherweise durch seine Auftritte mit der Telefon-Comedy-Crew „Studio Braun“ aufgefallen. In seinem aktuellen Roman „In Afrika“ schreibt er über eine weihnachtliche Kenia-Reise der beiden Kumpels H. und C – zeitgleich zu den dortigen Präsidentschaftswahlen. Ziel des Urlaubs ist nicht das Abenteuer an sich, sondern die Suche nach der Langeweile, was einen immer gleichen Tagesablauf voraus setzt: Struktur-gebend ist dabei lediglich die Einnahme von Mahlzeiten. Nach einigen Tagen rücken die beiden ihrem Ziel bereits näher, die Poolbars beginnen zu langweilen und auch die Casinos geben nicht mehr viel her. Die Beiden entschließen sich deshalb nach Mombasa zu fahren. Durch die dortigen Unruhen nach einer (angeblich) gefälschten Wahl verliert sich das Duo für kurze Zeit aus den Augen, C. schafft es dann aber doch wieder ins Hotel zurück. Für „eingefleischte“ Heinz Strunk-Fans ist „In Afrika“ auf jeden Fall ein Muss. Dem Freund von „junger Kultur“ – trotz des Jahrgangs 1962 des Autors – dürfte wohl eher die Lesung zu empfehlen sein. Die eigenwillige Betonung und der sich daraus entwickelnde Wortwitz von Herrn Strunk geht in Schriftform leider etwas verloren. (K. Reschke)
 Alle Fans vom „Boss“ dürfen sich derweil über eine amüsante Geschichte zum Thema Heiraten freuen. Tom ist nämlich nicht nur großer Springsteen-Fan, er steht auch vor der großen Frage, ob er sein weiteres Leben mit einer bestimmten Frau verbringen soll. Er kommt zunehmend ins Grübeln, ob seine Herzallerliebste ihn auch wirklich zum Mann haben will? Hat Selbstzweifel, Existenzängste, das volle Programm. Und weil ihm die Songs von Springsteen (die sonst ja für jede Lebenslage die passende Lösung in petto haben) in diesem Zusammenhang keine zufrieden stellende Antwort liefern, macht er sich einfach auf den Weg, Bruce Springsteen höchstpersönlich mit seinen Fragen löchern. „Was würde der Boss tun?“ ist ein hoffnungslos romantisches Buch über die Liebe (zur Musik). Dominik Schütte schickt seinen Protagonisten auf Selbstfindungstrip und textet dabei so locker flockig drauf los, wie man es von seinen Artikel für das „Neon“-Magazin bereits gewohnt ist. Es entsteht ein liebenswürdiger, bisweilen witziger Männer-Roman, der nicht nur die innige Liebe zur Rockmusik skizziert, sondern auch zahlreiche Ratschläge fürs Leben mitliefert. Dominik Schütte ist ein äußerst gelungenes Gedankenexperiment im Stil von „High Fidelity“ gelungen. Nicht nur für Springsteen-Fans interessant. Und damit Schluss für heute. Wir wünschen allen Lesern eine Frohe Osterei-Sucherei.
Alle Fans vom „Boss“ dürfen sich derweil über eine amüsante Geschichte zum Thema Heiraten freuen. Tom ist nämlich nicht nur großer Springsteen-Fan, er steht auch vor der großen Frage, ob er sein weiteres Leben mit einer bestimmten Frau verbringen soll. Er kommt zunehmend ins Grübeln, ob seine Herzallerliebste ihn auch wirklich zum Mann haben will? Hat Selbstzweifel, Existenzängste, das volle Programm. Und weil ihm die Songs von Springsteen (die sonst ja für jede Lebenslage die passende Lösung in petto haben) in diesem Zusammenhang keine zufrieden stellende Antwort liefern, macht er sich einfach auf den Weg, Bruce Springsteen höchstpersönlich mit seinen Fragen löchern. „Was würde der Boss tun?“ ist ein hoffnungslos romantisches Buch über die Liebe (zur Musik). Dominik Schütte schickt seinen Protagonisten auf Selbstfindungstrip und textet dabei so locker flockig drauf los, wie man es von seinen Artikel für das „Neon“-Magazin bereits gewohnt ist. Es entsteht ein liebenswürdiger, bisweilen witziger Männer-Roman, der nicht nur die innige Liebe zur Rockmusik skizziert, sondern auch zahlreiche Ratschläge fürs Leben mitliefert. Dominik Schütte ist ein äußerst gelungenes Gedankenexperiment im Stil von „High Fidelity“ gelungen. Nicht nur für Springsteen-Fans interessant. Und damit Schluss für heute. Wir wünschen allen Lesern eine Frohe Osterei-Sucherei.
UND WAS NUN?