 Mit der Band Klee ist das immer so eine Sache gewesen. Manche halten die Kölner um Sängerin Suzie für die nahezu perfekte Pop-Versuchung. Andere wiederum bemängeln, dass sie ähnlich wie die Kollegen von Virginia Jetzt! immer wieder die alte Leier abspulen, die sie bereits mit Songs wie „Erinner dich“ und „Zwei Fragen“ perfektionierten. Demnach ist „Aus lauter Liebe“ dann auch ein ziemlich mutiger Albumtitel, da er einem überhaupt nicht vorzugaukeln versucht, es könnte sich in naher Zukunft irgendetwas daran ändern. Stellt sich letztlich nur die Frage, ob die Band mit diesen oftmals kitschigen, manchmal sommerlichen, hin und wieder beschwingten, bisweilen zärtlichen, alles in allem einfach liebenswerten Songs in allerhöchste Chart-Gefilde vorstößt oder die alte Liebe der Fans so langsam zu rosten beginnt. Soll heißen: dieses Album setzt auf alles oder nichts. Kompromissloser geht’s kaum. Da bleibt uns nur viel Glück zu wünschen.
Mit der Band Klee ist das immer so eine Sache gewesen. Manche halten die Kölner um Sängerin Suzie für die nahezu perfekte Pop-Versuchung. Andere wiederum bemängeln, dass sie ähnlich wie die Kollegen von Virginia Jetzt! immer wieder die alte Leier abspulen, die sie bereits mit Songs wie „Erinner dich“ und „Zwei Fragen“ perfektionierten. Demnach ist „Aus lauter Liebe“ dann auch ein ziemlich mutiger Albumtitel, da er einem überhaupt nicht vorzugaukeln versucht, es könnte sich in naher Zukunft irgendetwas daran ändern. Stellt sich letztlich nur die Frage, ob die Band mit diesen oftmals kitschigen, manchmal sommerlichen, hin und wieder beschwingten, bisweilen zärtlichen, alles in allem einfach liebenswerten Songs in allerhöchste Chart-Gefilde vorstößt oder die alte Liebe der Fans so langsam zu rosten beginnt. Soll heißen: dieses Album setzt auf alles oder nichts. Kompromissloser geht’s kaum. Da bleibt uns nur viel Glück zu wünschen.
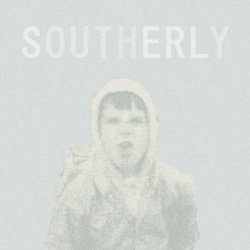 Southerly begeistern uns auf ihrem neuen Album mit düsterer Indie-Pop-Atmosphäre. Ein nebliger Schleier schlingt sich um die Hüften des Zuhörers und lädt dazu ein, im dynamisch arrangierten, musikalischen Kosmos der Jungs zu versinken. „Youth“ klingt von der ersten Minute an nach Aufbruch. Allein schon beim Opener „Suffer“ hängen die Gitarren dermaßen tief, dass man sich als Hörer auf der Stelle in hoffnungsloses Mitwippen verstrickt, ehe man von einer Pianomelodie abgeholt wird, die den Weg frei macht für orchestrale Arrangements. Die zwölf Songs der Scheibe ergänzen sich perfekt. Man wird sich deshalb auch sehr schwer tun hier eine Single auszumachen. Dieses Album sollte als das genommen werden, was es ist: ein Manifest des romantisierenden Trauer-Pops, das sich nicht davor scheut, auch mal die eigene Zerrissenheit nach außen zu kehren. Ein beeindruckendes Werk.
Southerly begeistern uns auf ihrem neuen Album mit düsterer Indie-Pop-Atmosphäre. Ein nebliger Schleier schlingt sich um die Hüften des Zuhörers und lädt dazu ein, im dynamisch arrangierten, musikalischen Kosmos der Jungs zu versinken. „Youth“ klingt von der ersten Minute an nach Aufbruch. Allein schon beim Opener „Suffer“ hängen die Gitarren dermaßen tief, dass man sich als Hörer auf der Stelle in hoffnungsloses Mitwippen verstrickt, ehe man von einer Pianomelodie abgeholt wird, die den Weg frei macht für orchestrale Arrangements. Die zwölf Songs der Scheibe ergänzen sich perfekt. Man wird sich deshalb auch sehr schwer tun hier eine Single auszumachen. Dieses Album sollte als das genommen werden, was es ist: ein Manifest des romantisierenden Trauer-Pops, das sich nicht davor scheut, auch mal die eigene Zerrissenheit nach außen zu kehren. Ein beeindruckendes Werk.
 Unter dem Banner Cashier No. 9 haben der renommierte Film- und Musik-Produzent David Holmes und Sänger Danny Todd derweil ein imposantes 60s-Manifest zusammengezimmert. Die Scheibe ist ein gefundenes Fressen für all jene, die sich schon immer gefragt haben, wie es wohl klingen würde, wenn die Flaming Lips eine Scheibe der Beatles nachspielen würden. „To The Death Of Fun“ nimmt einen bei der Hand mit seinen zahllosen Melodien und schleudert einen in ferne Realitäten. Wer auf „Strawberry Fields Forever“, „Penny Lane“ und Konsorten steht, ist bei Cashier No. 9 an der richtigen Adresse.
Unter dem Banner Cashier No. 9 haben der renommierte Film- und Musik-Produzent David Holmes und Sänger Danny Todd derweil ein imposantes 60s-Manifest zusammengezimmert. Die Scheibe ist ein gefundenes Fressen für all jene, die sich schon immer gefragt haben, wie es wohl klingen würde, wenn die Flaming Lips eine Scheibe der Beatles nachspielen würden. „To The Death Of Fun“ nimmt einen bei der Hand mit seinen zahllosen Melodien und schleudert einen in ferne Realitäten. Wer auf „Strawberry Fields Forever“, „Penny Lane“ und Konsorten steht, ist bei Cashier No. 9 an der richtigen Adresse.
 Wer auf Ska-Punk steht, der hin und wieder auch mal den sanften Saiten des Lebens frönt, der sollte sich mal das aktuelle Album von The King Blues zu Gemüte führen. „Punk & Poetry“ wandelt auf dem schmalen Grad zwischen den Mad Caddies & Anti-Flag und sorgt auf diesen Weise für eine imposante Dreiviertelstunde, die man sich immer wieder aufs Neue zu Gemüte führen möchte. Dieses Album liefert die perfekten Hymen zum sommerlichen Festivaltape. Songs zum Abfeiern, Herzen und Mitgröhlen. Wer seinen Sommerpunk gerne mit sozialkritischem Unterton serviert bekommen mag, sollte sich dieses Werk auf keinen Fall entgehen lassen.
Wer auf Ska-Punk steht, der hin und wieder auch mal den sanften Saiten des Lebens frönt, der sollte sich mal das aktuelle Album von The King Blues zu Gemüte führen. „Punk & Poetry“ wandelt auf dem schmalen Grad zwischen den Mad Caddies & Anti-Flag und sorgt auf diesen Weise für eine imposante Dreiviertelstunde, die man sich immer wieder aufs Neue zu Gemüte führen möchte. Dieses Album liefert die perfekten Hymen zum sommerlichen Festivaltape. Songs zum Abfeiern, Herzen und Mitgröhlen. Wer seinen Sommerpunk gerne mit sozialkritischem Unterton serviert bekommen mag, sollte sich dieses Werk auf keinen Fall entgehen lassen.
 Die Ganglians könnten alle gefallen, die sich zuletzt an den ruhigeren Momenten der Vaccines ergötzten. Die Band aus dem schönen Sacramento strahlt so einen gewissen Übermut aus, der Lust auf eine Zugabe macht. Da stört es herzlich wenig, dass hin und wieder auch mal in psychedelische Gefilde abgedriftet wird. Alles in allem findet „Still Living“ nämlich immer wieder in die Spur zurück und dürfte so manchem Nachtspaziergang im Mondschein an einer einsamen Strandpromenade den passenden Flair verleihen.
Die Ganglians könnten alle gefallen, die sich zuletzt an den ruhigeren Momenten der Vaccines ergötzten. Die Band aus dem schönen Sacramento strahlt so einen gewissen Übermut aus, der Lust auf eine Zugabe macht. Da stört es herzlich wenig, dass hin und wieder auch mal in psychedelische Gefilde abgedriftet wird. Alles in allem findet „Still Living“ nämlich immer wieder in die Spur zurück und dürfte so manchem Nachtspaziergang im Mondschein an einer einsamen Strandpromenade den passenden Flair verleihen.
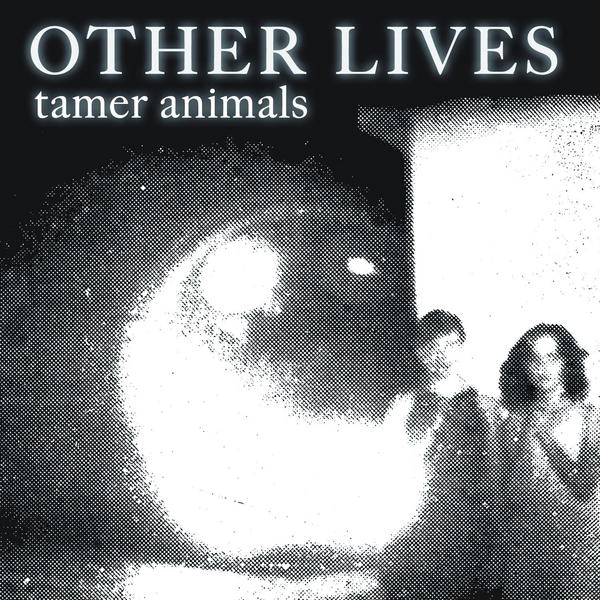 Other Lives sind nicht nur eine weitere Band der schönen Gattung „Chamber-Pop“, sie sorgen im Gegensatz zu vielen Weggefährten auch dafür, dass man sich hoffnungslos in sie verknallt. „Tamer Animals“ klingt wie ein düsterer Bastard aus Bad Seeds-Anleihen und Radioheadscher Experimentierfreude. Da wundert es am Ende auch nicht, dass hier Becks langjähriger Schlagzeuger Joey Waronker hinter den Reglern Platz genommen hat. Wer auf den Sound von The National und Konsorten steht, sollte sich dieses Werk reinziehen. Es wird ihm sein dunkles Herz zerreißen.
Other Lives sind nicht nur eine weitere Band der schönen Gattung „Chamber-Pop“, sie sorgen im Gegensatz zu vielen Weggefährten auch dafür, dass man sich hoffnungslos in sie verknallt. „Tamer Animals“ klingt wie ein düsterer Bastard aus Bad Seeds-Anleihen und Radioheadscher Experimentierfreude. Da wundert es am Ende auch nicht, dass hier Becks langjähriger Schlagzeuger Joey Waronker hinter den Reglern Platz genommen hat. Wer auf den Sound von The National und Konsorten steht, sollte sich dieses Werk reinziehen. Es wird ihm sein dunkles Herz zerreißen.
 Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal ein Album von Jennifer Rostock im Wach-Zustand bis zum Ende durchlaufen lassen würde. Noch dazu schien es mir bis vor Kurzem komplett abwegig, dieser Band auch nur einen Hauch Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Dann aber krachte plötzlich die Erkenntnis in Form des Tracks „Mein Mikrofon“ auf mich ein. Was für ein Song, wass´n Hit. Da können sich alle die Silbermonde da draußen eine dicke Scheibe von abschneiden. Das aktuelle Album „Mit Haut und Haar“ kann da zwar nur bedingt mithalten, sorgt aber für reichlich Abwechslung über die volle Distanz und fängt im Gegensatz zur Musik von Juli auch nicht nach der Hälfte der Scheibe an zu lahmen. Alles in allem scheinen Jennifer Rostock auf dem besten Weg zu sein, sich von allen Erwartungshaltungen freizuschwimmen, schlecht gereimte Quotenballaden, die im Formatradio Platz finden sucht man jedenfalls vergebens. Deshalb mehr davon bitte. Und das nächste Mal noch ein wenig kompromissloser zu Werke gehen.
Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal ein Album von Jennifer Rostock im Wach-Zustand bis zum Ende durchlaufen lassen würde. Noch dazu schien es mir bis vor Kurzem komplett abwegig, dieser Band auch nur einen Hauch Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Dann aber krachte plötzlich die Erkenntnis in Form des Tracks „Mein Mikrofon“ auf mich ein. Was für ein Song, wass´n Hit. Da können sich alle die Silbermonde da draußen eine dicke Scheibe von abschneiden. Das aktuelle Album „Mit Haut und Haar“ kann da zwar nur bedingt mithalten, sorgt aber für reichlich Abwechslung über die volle Distanz und fängt im Gegensatz zur Musik von Juli auch nicht nach der Hälfte der Scheibe an zu lahmen. Alles in allem scheinen Jennifer Rostock auf dem besten Weg zu sein, sich von allen Erwartungshaltungen freizuschwimmen, schlecht gereimte Quotenballaden, die im Formatradio Platz finden sucht man jedenfalls vergebens. Deshalb mehr davon bitte. Und das nächste Mal noch ein wenig kompromissloser zu Werke gehen.
 Zum Ende hin wird es ernst. Nach ihrem fulminanten Sommerhit „The Greeks“ müssen die Kollegen von Is Tropical ihre Qualitäten nun über die volle Distanz eines Albums unter Beweis stellen. Und so viel schon mal vorneweg: sie meistern diese Hürde ganz bravourös. „Native To“ hat alles, was ein zeitgemäßes Indie-Pop-Album braucht. Treibende Elektro-Bretter, verschwurbelte Beats und mindestens zwei weitere Tanzboden-Bretter namens „Lies“ und „Think We´re Alone“, die dafür sorgen, dass du dir die Hüften beim Durchdrehen verrenkst. Wer auf Two Door Cinema Club und Konsorten steht, sollte unbedingt mal rein hören. Dieser Tropenpop mit Elektro-Breitseite sollte gefeiert werden, solange er heiß ist. Und damit Schluss für heute. Wir lesen uns beim nächsten Zuckerbeat.
Zum Ende hin wird es ernst. Nach ihrem fulminanten Sommerhit „The Greeks“ müssen die Kollegen von Is Tropical ihre Qualitäten nun über die volle Distanz eines Albums unter Beweis stellen. Und so viel schon mal vorneweg: sie meistern diese Hürde ganz bravourös. „Native To“ hat alles, was ein zeitgemäßes Indie-Pop-Album braucht. Treibende Elektro-Bretter, verschwurbelte Beats und mindestens zwei weitere Tanzboden-Bretter namens „Lies“ und „Think We´re Alone“, die dafür sorgen, dass du dir die Hüften beim Durchdrehen verrenkst. Wer auf Two Door Cinema Club und Konsorten steht, sollte unbedingt mal rein hören. Dieser Tropenpop mit Elektro-Breitseite sollte gefeiert werden, solange er heiß ist. Und damit Schluss für heute. Wir lesen uns beim nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?